Klimaneutralität bis 2045 – dieses Ziel hat sich die Bundesrepublik gesetzt. Im neuen niedersächsischen Klimagesetz wird sogar die Zielmarke 2040 anvisiert. Aber wie soll das funktionieren, wenn gerade im Gebäudesektor eine scheinbar überwältigende Mammutaufgabe auf die Kommunen zukommt? Beim elften Energieforum der Leuphana Universität Lüneburg ging es nun insbesondere um diese Frage, bei deren Beantwortung die Fachleute aus Wissenschaft und Verwaltung immer wieder einen Punkt betonten: „Die Gesetze, die wir haben, sind nicht scharf genug“, brachte es Prof. Thorsten Müller auf den Punkt.

Der Leiter der Stiftung Umweltenergierecht aus Würzburg hatte sich für seinen Impulsvortrag auf die Suche nach einem rechtlichen Leitfaden gemacht, der die Kommunen durch die Energie- und Wärmewende führt. Statt klarer Regelungen habe er nur eine unübersichtliche Menge an Vorgaben gefunden, die in ihrer fehlenden Systematik selbst einen Juraprofessor herausforderten. „In allen Feldern gibt es zwar Normen, die die Kommunen auch dazu verpflichten, dass sie Klimaschutz betreiben. Weder der Bundes- noch der Landesgesetzgeber adressiert aber bisher die Kommunen als strategischen Akteur im Bereich des Klimaschutzes“, kritisierte Müller und hält das für einen riesigen Fehler. Das Aufstellen von Mindestzielen beim Klimaschutz setze schließlich darauf, dass es Akteure gibt, die diese Ziele übertreffen. „Das können Kommunen sein. Dafür brauchen wir aber den richtigen Rechtsrahmen“, so der gebürtige Wolfenbütteler.
Dass jetzt ein Teil der Kommunen verpflichtet wurde, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen, hält Müller grundsätzlich für den richtigen Schritt. „Das Zeitfenster von jetzt bis 2045 ist jedoch so kurz, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit diesen seichten Instrumenten zum Ziel kommen“, sagte der Rechtswissenschaftler. Dass die kommunale Wärmeplanung erst einmal „rechtsfolgenlos“ ist, also nur eine reine Handlungsempfehlung, hält der Jurist für diskutabel. „Man könnte die kommunale Wärmeplanung auch noch weiterdenken, als sie derzeit konzipiert ist. Aber wir brauchen ja auch noch Entwicklungsschritte nach vorne“, sagte er und lachte. Die Angst der Kommunen vor dem Verlust der kommunalen Selbstverwaltung kann Müller jedoch nachvollziehen. Die Politik greife beim Klimaschutz bislang eigentlich nur dort durch, wo die Widerstände am geringsten sind – und das sei die kommunale Ebene.
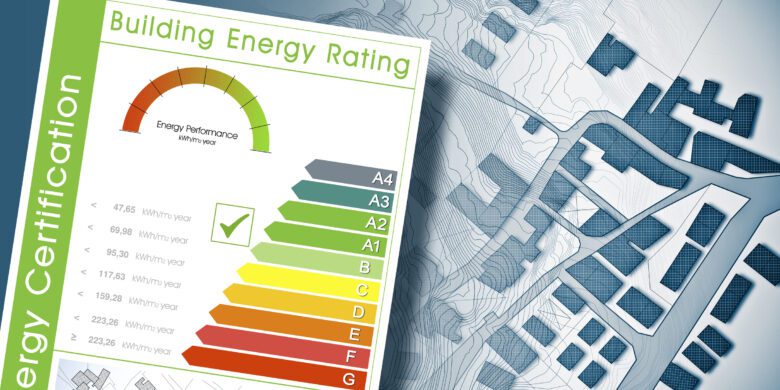
„Wir haben nicht das Problem, dass wir daran zweifeln, ob der Weg der richtige ist, sondern wir haben ein Durchsetzungsproblem“, bemängelte der Experte für Umweltrecht. Er forderte weniger „Top-Down-Vorgaben“ und mehr „Aushandeln in den Parlamenten“. Den Einwand eines Samtgemeindemitglieds aus dem Publikum, dass juristisch gar nicht geklärt sei, was Klimaneutralität eigentlich genau bedeute, bestätigte Müller zwar als richtig. Der Rechtswissenschaftler sagte aber auch: „Das macht nichts, wir können trotzdem anfangen. Ich würde behaupten: Sie brauchen diese Definition nicht für ihr alltägliches Handeln. Wenn wir uns darauf verständigen, CO2 und Methan überall dort zu vermeiden, wo es möglich ist, haben wir für die nächsten zehn Jahre mehr als genug zu tun.“
In der niedersächsischen Landesregierung gibt es ebenfalls den Wunsch nach schärferen Regeln. „Klimaschutz darf keine freiwillige Aufgabe sein, die die Kommunen nur machen, wenn sie etwas Geld übrighaben. Klimaschutz muss zur Pflichtaufgabe werden, denn Klimaschutz ist Menschenschutz und Daseinsvorsorge und alles andere als Kür“, sagte Anka Dobslaw, Staatssekretärin im Umweltministerium. Insbesondere bei der Wärmewende komme der kommunalen Ebene eine Schlüsselrolle zu. Dass die 47 größten Kommunen in Niedersachsen ab 2024 gesetzlich verpflichtet sind, Klimaschutzkonzepte für die eigene Verwaltung aufzustellen, hält Dobslaw deswegen für einen wichtigen Schritt: „Damit ist zumindest für jeden Landkreis und jede große Stadt Klimaschutz als Daueraufgabe verankert.“

Die studierte Umweltwissenschaftlerin verteidigte auch die Entscheidung, alle Mittel- und Oberzentren in Niedersachsen zum Aufstellen einer kommunalen Wärmeplanung zu verpflichten. Dass der Bund allerdings andere Vorgaben an die Kommunen machen will als Niedersachsen, hält sie für ein Problem. Niedersachsen wolle sich deswegen mit anderen Bundesländern zusammenschließen, um eine „möglichst weitgehende Länderöffnungsklausel“ zu erreichen. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass die niedersächsischen Regeln weiter gelten können und nicht neu geplant werden muss“, sagte die Staatssekretärin.
Eine im Bundesgesetzentwurf geplante Ausweitung der Pflicht zur Klimastrategieplanung auf kleinere Kommunen sieht Dobslaw mit Vorsicht. Hier droht laut der Staatssekretärin die Gefahr, die kleineren Städte und Gemeinden zu überfordern. Und auch die Bedenken der Kommunen, dass die Landesregierung die neuen Aufgaben nicht entsprechend refinanziert, nehme sie ernst. „Es wird uns immer wieder gespiegelt, dass es noch höhere Bedarfe gibt. Mir ist klar, dass von kommunaler Seite der Wunsch nach höheren Mitteln besteht. Wir werden noch einmal kritisch prüfen: Reicht das oder reicht das nicht“, versprach Dobslaw.
„Wir haben keine große Wärmewende in Deutschland, wir haben 8000 kleine Wärmewenden“, sagte Axel Dosch vom Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) in Halle. Die Pläne, alle 8000 Kommunen in Deutschland zu einer kommunalen Wärmeplanung zu verpflichten, hält der Strukturpolitikexperte jedoch für „sehr ambitioniert“. „Gerade die kleineren Kommunen werden die Frist bis 2028 auch mit Unterstützung nur sehr schwer schaffen“, sagte der Kommunalberater. Gerade mal 50 Kommunen in Deutschland hätten schon eine kommunale Wärmeplanung, 400 weitere seien derzeit in der Mache – die Hälfte davon in Baden-Württemberg, das unter den Bundesländern mutig vorangegangen ist.

Gerade im Vergleich mit Dänemark, wo das schon längst Standard ist, sei die Bundesrepublik zwar viel zu spät dran. Es dürfe jetzt aber nicht „quick and dirty“ gehandelt werden. „Auch wenn der Zeitdruck groß ist, müssen wir einen gewissen Qualitätsstandard sicherstellen“, betonte Dosch. Die KWW als „kleines Schnellboot der Deutschen Energie-Agentur“ (DENA) habe deswegen auch vom Bundeswirtschaftsministerium die Aufgabe bekommen, den Kontakt in die Fläche zu halten. Vom Ortsbürgermeister bis zum Oberbürgermeister könne sich jeder Kommunalvertreter an das Kompetenzzentrum wenden und Hilfe bei der Wärmeplanung erhalten.
„Man muss den Kommunen auch mal kritisch sagen: Es liegt ja nicht nur am Geld“, sagte Dosch. Die Wärmewende scheitere viel eher an mangelndem Willen. Sein Credo lautet daher: Nicht nur planen, sondern einfach machen. „Wir müssen den Gebäudebestand massiv erneuern, wir müssen auch in Wärmepumpen und thermische Bohrungen massiv investieren. Wir brauchen Bürgergenossenschaften, bürgerliches Engagement und Heizungsbauer, die nicht sagen: Ich kann Ihnen keine Wärmepumpe liefern, sondern: Ich kann Ihnen aber in sechs Monaten eine Wärmepumpe liefern“, sagte der leidenschaftliche Regionalentwickler.
Trotz aller Hürden sei er optimistisch, dass Deutschland bei der Wärmewende im Gebäudesektor zügige Fortschritte machen wird, denn schließlich könne man das nicht einfach aussitzen. Dosch: „Die Verpflichtung zum Klimaschutz ist ja keine Spinnerei von links-grün gestrickten Halunken wie mir, das hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen. Und jede nachfolgende Generation hat das Recht darauf, dass wir da den Hintern hochkriegen.“



