Der Konsumforscher Prof. Nick Lin-Hi von der Universität Vechta beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie sich Fleisch aus dem Reagenzglas am Markt wird durchsetzen können. Im Gespräch mit Rundblick-Redakteur Niklas Kleinwächter erläutert er, warum Innovationen gerade anderswo als in Deutschland vorangebracht werden und wieso er die deutsche Zurückhaltung insbesondere für ein Agrarland wie Niedersachsen für ein Problem hält.

Rundblick: Prof. Lin-Hi, als wir vor gut drei Jahren zuletzt miteinander gesprochen haben, prognostizierten Sie, dass es noch zwei bis vier Jahre dauern werde, bis Fleisch aus dem Reagenzglas im Supermarkt verkauft werden kann. Wie weit sind wir denn jetzt damit?
Prof. Lin-Hi: Da war ich wohl zu zurückhaltend, denn schon im Dezember 2020 gab es die erste Zulassung – in Singapur. Ob es eine Zulassung auch in Deutschland geben wird, ist allerdings eine andere Sache, das sagte ich auch damals schon. Aber um uns herum tut sich gerade eine Menge. Im vergangenen November wurde der erste Zulassungsantrag in den USA gestellt, der inzwischen genehmigt wurde. Damit wurde auf einen Schlag der größte Konsummarkt der Welt für kultiviertes Fleisch geöffnet. Das ist ein starkes Signal!
„Die Zulassung ist nun erst einmal der nächste Schritt, um die Revolution anzustoßen.“
Rundblick: Die Zulassung ist also da, aber ist es auch praktisch schon möglich, dass Fleisch hergestellt wird, ohne dass Tiere dafür geschlachtet werden müssen?
Prof. Lin-Hi: Ja, das ist bereits möglich. Allerdings reden wir noch über sehr kleine Produktionsmengen. Es wird zurzeit noch daran gearbeitet, wie das, was im Labor funktioniert, auch im industriellen Maßstab gelingen kann. Die Zulassung ist nun erst einmal der nächste Schritt, um die Revolution anzustoßen.
Rundblick: Sie sprechen von einer Revolution, aber wir Deutschen neigen da ja eher nicht so zu.
Prof. Lin-Hi: In der Tat ist festzustellen, dass sich die Innovationen in diesem Bereich derzeit außerhalb Deutschlands und auch weitgehend außerhalb der Europäischen Union vollziehen. Die USA, Israel und Singapur liegen hier vorne. Aber auch in der Schweiz passiert etwas. Mit einem schweizerischen Start-up arbeitet dann auch das deutsche Unternehmen „Rügenwalder Mühle“ zusammen, die sich schon seit längerem mit Alternativen in der Fleischproduktion beschäftigen. Aber für die Forschung zu kultiviertem Fleisch scheinen sie hierzulande keine Kooperationspartner zu finden.

Rundblick: Glauben Sie, dass sich da in der EU bald etwas ändern könnte?
Prof. Lin-Hi: Das wird in der EU alles andere als einfach. Es gibt erste Vorgespräche auf Zulassung für den „kultivierten Hot Dog“. Aber es wird wohl einige Jahre dauern, bis dieser das zweistufige Verfahren der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) durchlaufen hat. Ob das dann gut ausgeht, ist alles andere als sicher. Die erste Stufe des Verfahrens ist objektiv und basiert auf Daten und Fakten, da bewertet die EU etwa die Produktsicherheit. In der zweiten Stufe werden dann die Mitgliedstaaten gefragt: Wollen wir das? Diese zweite Phase macht mir Bauchschmerzen, denn es ist ja nicht so, dass die Politik immer auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse urteilt. Da spielen dann auch viele Partikularinteressen eine Rolle. Die EU sieht an dieser Stelle eine qualifizierte Mehrheit vor, was bedeutet, dass 55 Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen müssen und diese Länder zudem mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union repräsentieren müssen. Aktuell positionieren sich Frankreich, Italien, Rumänien und Österreich dagegen. Kommt noch ein weiteres Land hinzu, wird die 65-Prozent-Schwelle nicht erreicht.
„Die bereits existierenden Player sind meist innovationsfeindlich.“
Rundblick: Woher kommt diese Zurückhaltung in Politik und Industrie?
Prof. Lin-Hi: Die Praxis verrät uns, dass neue Technologien in aller Regel von Outsidern kommen, denken wir beispielsweise an Elektroautos von Tesla oder Smartphones von Apple. Beide Unternehmen waren vorher in den entsprechenden Märkten nicht vertreten. Die bereits existierenden Player sind meist innovationsfeindlich aus einem ganz einfachen Grund: Sie würden sonst ja die Basis ihres eigenen Erfolgs unterminieren. Soll heißen: Wenn jemand Schweinefleisch produziert, dann sieht er Fleischproduktion in der Petrischale als Gefahr für sein aktuelles Geschäftsmodell. Ich halte eine solche Logik indes für fatal. Die Zukunft lässt sich nicht aufhalten. Wer nicht mitgeht, den erwischt es später.
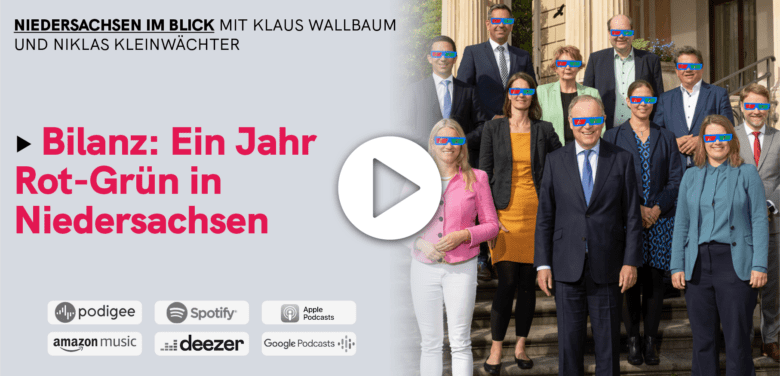
Rundblick: Was raten Sie der Industrie?
Prof. Lin-Hi: Es braucht Beidhändigkeit als Strategie. Mit der einen Hand macht man weiter, wie bisher. Mit der anderen aber muss man das Neue aufbauen. Wir reden hier über eine sehr disruptive Technologie, da weiß man nie, wann sie sich durchsetzt. Es ist keine lineare Entwicklung, sondern irgendwann wird es einen Durchbruch geben und dann ist es nicht mehr wie zuvor, sondern steigt exponentiell – wie beim Popcorn-Effekt. Wir müssen da also vorher rein und das machen wir nicht gut. Gerade für ein Agrarland wie Niedersachsen ist das eine wichtige Zukunftsfrage, sonst erlebt nach der Automobilindustrie auch noch der zweitwichtigste Wirtschaftszweig ein Desaster.
„Ein Forschungs-Cluster zum kultivierten Fleisch wäre doch etwas, in das es sich zu investieren lohnt.“
Rundblick: Was könnte die Politik, insbesondere hier in Niedersachsen, nun besser machen?
Prof. Lin-Hi: Niedersachsens Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat dankenswerterweise unsere Zukunftsdiskurse zu kultiviertem Fleisch mit 120.000 Euro unterstützt. Das hat es uns ermöglicht, die erste wissenschaftliche Tagung zu kultiviertem Fleisch in Deutschland durchzuführen – ein wichtiger Schritt. Was wir nun aber brauchen, ist eine Bündelung der Expertise in einem interdisziplinären Forschungsverbund, um die Grundlagenforschung voranzutreiben. Mediziner forschen zu Stammzellen. Ingenieure bringen den 3D-Druck voran, damit formlose Fleischfasern in Struktur gebracht werden können. Wir brauchen Trägergerüste, die essbar sind, und ein Nährmedium, um die Zellen zu füttern. Ökonomen müssten Markteintrittsstrategien entwickeln. Außerdem müssen ethische, rechtliche und psychologische Komponenten bedacht werden. Niedersachsen verfügt doch gerade über die VW-Sonderdividende – ein Forschungs-Cluster zum kultivierten Fleisch wäre doch etwas, in das es sich zu investieren lohnt.
Rundblick: Sie verwenden in unserem Gespräch konsequent die Bezeichnung „kultiviertes Fleisch“. Wieso?
Prof. Lin-Hi: In der Akzeptanzforschung haben wir festgestellt, dass das „Wording“ entscheidend ist. Die Medien verwenden gerne den Begriff „Laborfleisch“, weil er so schön anschaulich ist. Aber auch die Kritiker dieser Technik nutzen das Wort, weil es weniger Akzeptanz auslöst als „kultiviertes Fleisch“. Wenn die Kunden aber erst einmal selbst erfahren, dass das Fleisch ebenso gut schmeckt und sogar gesünder sein kann, weil man beispielsweise Folsäure beimengen kann, und dann irgendwann auch noch der Preis stimmt, dann wird sich die neue Technologie durchsetzen.


