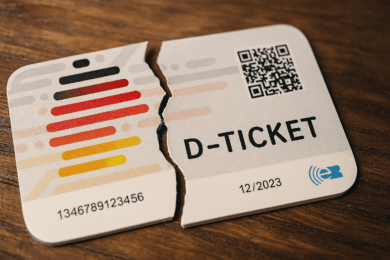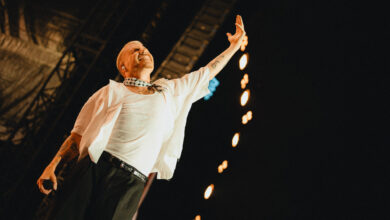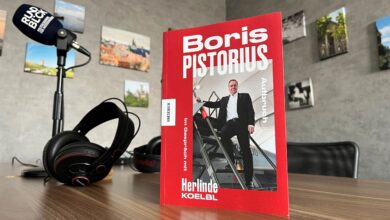Möchte man in Niedersachsen über die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie diskutieren, drängt sich Olaf Lies (SPD) als Gesprächspartner förmlich auf. Nachdem er zuerst von der Spitze des Wirtschaftsministeriums an die des Umweltministeriums gewechselt ist, kümmert er sich im dritten Kabinett von Stephan Weil (SPD) nun erneut um die Ökonomie. Ein „überzeugter Wiederholungstäter“ sei er offenbar, moderierte Christoph Dahling-Sander, Sekretär der Hanns-Lilje-Stiftung, den Minister kürzlich an.

„Ihm scheint das Thema wichtig zu sein, denn eine Zusage zu dieser Veranstaltung habe ich bereits innerhalb von 24 Stunden erhalten“, ließ Dahling-Sander die Gäste in der Neustädter Hof- und Stadtkirche, in der das Hanns-Lilje-Forum stattfand, wissen. Lies selber bemühte sich sogleich, die Latte der Ansprüche und Erwartungen etwas niedriger zu hängen. Wenn ein Wirtschaftsminister etwas dazu sagen soll, wie Umweltschutz und wirtschaftliches Handeln in Einklang gebracht werden können, dann sei das „nichts, wo man punkten kann, aber sich der Debatte stellen muss.“
Dass jemand vom Wirtschafts- zum Umweltminister und dann wieder zum Wirtschaftsminister wird, das gehe sogar gut, gab sich Lies derweil überzeugt. Und dass das für ihn so gut geht, hängt auch mit seinem Politikstil zusammen, der wiederum viel mit Umarmungen zu tun hat. „Man muss offen sein für das Gegenüber“, fasst Lies selbst seine Grundeinstellung zusammen, die sich beispielsweise auch beim Erfolgsmodell „niedersächsischer Weg“ gezeigt habe, bei dem Umweltverbände und die Landwirtschaft gemeinsam an neuen Gesetzen gearbeitet haben.
Vermeintliche Gegensatzpaare haben sich an einen Tisch gesetzt und ausgearbeitet, was gerade so noch geht, damit beide Seite damit leben können. „Das Ganze hatte allerdings einen Makel“, räumte Lies kokett ein: „Das war ein Kompromiss.“ Als weiteres Beispiel dafür, dass die beiden gegensätzlichen Pole miteinander vereinbar seien, verweist Lies auf Bio-Zucker. Der unterscheide sich in der Qualität zwar nicht vom herkömmlichen Zucker. Die Verbraucher seien allerdings dazu bereit, für eine ökologisch bessere Herstellung mehr Geld zu zahlen. „Der Kunde ist bereit, das zu honorieren.“

Wie steht es ansonsten aber um das mögliche Gleichgewicht des Gegensatzpaares Ökonomie und Ökologie? An der großen Herausforderung der jüngsten Zeit, dem Ukraine-Krieg und der daraus folgenden Energie-Krise, lasse sich einiges herleiten, so Lies: „Alles, was wir zuvor getan haben, haben wir nur für die Ökonomie getan.“ Bei der Kohleverstromung an der Küste beispielsweise seien 58 Prozent der Energie als Wärme ans Meer abgegeben worden, 55 Prozent unseres Energiebedarfs habe man dann aber durch russisches Gas gedeckt – einfach, weil es billiger gewesen sei, führte der Minister aus.
„Wir haben nicht beides gemeinsam gedacht.“ Hätte man beispielsweise schon 2019 ein LNG-Terminal gebaut und die Energielieferungen breiter aufgestellt, hätte man nach Kriegsausbruch ganz andere Handlungsoptionen gehabt. Quasi als Gegenreaktionen zu diesem jahrelangen Fehlverhalten forderte Friedrich Selter, evangelisch-lutherischer Regionalbischof für den Sprengel Osnabrück, beim Hanns-Lilje-Forum nun das Primat der Ökologie ein. „Weil das Gas so billig war, haben wir Dinge nicht getan, die man hätte tun müssen“, sagte er.

So weit will Lies vermutlich nicht gehen, er betont vielmehr, dass Ökologie und Ökonomie zudem noch mit dem Sozialen stets in Einklang gebracht werden müssen. Was heißt das aber konkret? Am Beispiel des Verzichts als mögliche Lösung lässt sich dieser floskelhafte Dreiklang vielleicht ganz gut erklären. „Verzicht als Idee muss funktionieren. Wir haben uns einen Lebensstil angewöhnt, bei dem das sein muss“, sagte Lies auf dem Podium. „Nachhaltige Produkte kaufen, bewusst ein Stück einschränken. Manchmal ist weniger sogar angenehmer, weil man dann mehr genießen kann.“

Einschränkendes kam jedoch aus verschiedenen Richtungen, zunächst von Benedikt Hüppe von den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN). „Als G7-Gesellschaft müssen wir auch anderen etwas anbieten. Wir können weite Teile Asiens und Afrikas nicht mit Verzicht hin zu mehr Klimaschutz bewegen. Wer nicht viel hat, kann auch nicht auf viel verzichten.“ Dem pflichtete auch Lies bei und sagte: „Wir machen den Fehler, dass wir Weltprobleme minimieren auf Probleme unseres direkten Umfelds. Dem Großteil der Welt geht es schlecht. Wir müssen das miteinander verbinden: Wir verzichten, und helfen den anderen dabei, ihre Wachstumswünsche auf eine andere Art und Weise zu erreichen, als wir das getan haben. Wir würden nicht gewinnen, wenn wir alle auf ein bisschen verzichten. Manchmal ist Verzichtsdebatte eine falsche Debatte.“
Eine Einschränkung aus der anderen Richtung kam von Rebekka Reinhold von der GEW-Jugend, die sagte: „Wir dürfen Verzicht nicht nur individuell denken. Arme Menschen sollen Bio kaufen?“ Es sei wichtig, das Soziale mitzudenken. „Man muss gemeinsam ins Gespräch kommen und alle Menschen mitnehmen, auch die Arbeiter, die vielleicht Ängste und Sorgen haben.“ Denen sollen Umschulungsmaßnahmen angeboten werden, an denen sie selber mitgestalten können.

Leonard Willen vom Umweltjugendnetzwerk „Janun“ formulierte die Verzichts-Forderung derweil noch radikaler: „Es braucht kollektiven Verzicht. Die unteren Einkommensschichten müssen merken, dass die Oben mehr verzichten.“ Als erfolgreiches Beispiel führt er die britische Kriegswirtschaft heran. Für Hüppe entwickelte sich die Diskussion an dieser Stelle zu einer „sehr deutschen Debatte“. Der Bäcker werde seine Brötchen zwar in der Region verkaufen, viele Produkte würden aber global gehandelt, wie beispielsweise Kupfer. „Deshalb ist es wichtig: Wenn wir kollektiv verzichten, muss es wirklich kollektiv sein.“

Wie aber soll es gelingen, Verzicht zum Wohle der Umwelt zugleich ökonomisch machbar als auch sozial gerecht auszugestalten? Hüppe verwies auf sogenannte Klima-Clubs, Zusammenschlüsse von Staaten, die ihr ökologisch ausgerichtetes Markthandeln aufeinander abstimmen. Er bezeichnete dieses Vorgehen als ein „zartes Pflänzchen“, bei dem Staaten miteinander vereinbaren würden, „gemeinsam zu laufen“, damit nicht alle gleich schnell laufen müssen. Willen reicht das allerdings noch nicht, all jene Maßnahmen, die auf Freiwilligkeit basieren, scheinen dem „Janun“-Mitglied nicht schnell und weit genug zu gehen. Hüppe erwidert darauf allerdings: „Wie sollte man denn ein anderes Land zwingen, etwas zu tun, von dem es nicht überzeugt ist?“
Die konkrete Frage blieb zwar unbeantwortet. Lies zeigte sich abschließend allerdings optimistisch, dass die Ökonomie Teil der Lösung sein kann. „Wie kann man Reiche dazu bewegen, ihren Beitrag zu leisten? CO2-Einsparen muss ein Business-Case sein! Das Kapital wird dorthin fließen, wo es sich lohnt. Damit kann die Wirtschaft Treiber und Lösung sein.“ Das habe sich beim Bio-Zucker gezeigt und zeige sich genauso beim grünen Stahl. Wenn sich Klimaschutz lohnt, wird er schon gemacht. Dann muss man auch niemanden zwingen, so die Hoffnung des Wirtschaftsministers.