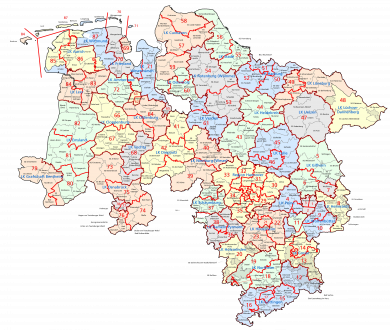Foto: evlka[/caption]
Rundblick: Herr Guntau, aus der Richtung der PDS und anderer Gruppen ist oft behauptet worden, den Menschen in den neuen Bundesländern sei nach der Wiedervereinigung ein politisches System „übergestülpt“ worden. Ist das etwas dran?
Guntau: Man muss differenzieren. Im Zusammenhang mit den Verhandlungen der beiden deutschen Staaten über den Einigungsvertrag kam unter Verfassungsrechtlern wie in der Öffentlichkeit eine heftige Diskussion auf, wie die Herstellung der Einheit Deutschlands zustande kommen sollte: ob über den Beitritt der ehemaligen DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes oder durch eine neue zu erarbeitende gesamtdeutsche Verfassung, die das Grundgesetz abgelöst hätte. Im August 1990 votierte die freigewählte Volkskammer der DDR für den Beitritt nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Neben diesem formal juristischen Sachverhalt traten zum anderen unvermittelt die faktischen Folgen zu Tage. Von heute auf morgen änderten sich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für die Bürger der ehemaligen DDR und verlangten ihnen eine immense Anpassungsleistung ab. Zeit, sich allmählich in das Neue zu finden, wurde ihnen nicht gewährt. Eine neue Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtsordnung wurde dem Land buchstäblich über Nacht in diesem Sinne in der Tat „übergestülpt“. Die mit der deutschen Vereinigung einhergehende Marktöffnung im Jahr 1990 war in vielerlei Hinsicht mit abrupten Veränderungen für die ostdeutsche Wirtschaft verbunden. Relativ geringe Produktivität in Verbindung mit stark gestiegenen Lohnkosten trug wesentlich zu einem dramatischen Arbeitsplatzabbau in Ostdeutschland in den ersten Jahren nach dem Systemumbruch bei. Kritisch zu sehen ist die Arbeit der Treuhand. Sie ging bei der Privatisierung der Ost-Wirtschaft oft ziemlich radikal vor, machte auch Fehler und ermöglichte sogar kriminelles Handeln. Die Treuhand ist der zentrale Punkt der schockartigen Nachwendeerfahrung. Für viele Älteren ist das bis heute ein hoch emotionales Thema. Vielfach wurde ihr Wirken als Herabsetzung empfunden. Da kamen Menschen aus Westdeutschland und erklärten der Belegschaft eines Betriebes, das er ist nichts wert ist, und in vielen Fällen führte dies zu seiner Liquidation. Das hat zu millionenfachen Verwundungen geführt. Man muss aber auch sehen, dass man nach 1990 auch keine westlichen Konzerne zwingen konnte, marode Firmen zu übernehmen und Verluste zu machen, weshalb sich Betriebsübernahmen eher auf „Perlen“ konzentrierten. Die bundesdeutsche Marktwirtschaft folgte eigenen Spielregeln und nicht politischem Wunschdenken.
Foto: evlka[/caption]
Rundblick: Herr Guntau, aus der Richtung der PDS und anderer Gruppen ist oft behauptet worden, den Menschen in den neuen Bundesländern sei nach der Wiedervereinigung ein politisches System „übergestülpt“ worden. Ist das etwas dran?
Guntau: Man muss differenzieren. Im Zusammenhang mit den Verhandlungen der beiden deutschen Staaten über den Einigungsvertrag kam unter Verfassungsrechtlern wie in der Öffentlichkeit eine heftige Diskussion auf, wie die Herstellung der Einheit Deutschlands zustande kommen sollte: ob über den Beitritt der ehemaligen DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes oder durch eine neue zu erarbeitende gesamtdeutsche Verfassung, die das Grundgesetz abgelöst hätte. Im August 1990 votierte die freigewählte Volkskammer der DDR für den Beitritt nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Neben diesem formal juristischen Sachverhalt traten zum anderen unvermittelt die faktischen Folgen zu Tage. Von heute auf morgen änderten sich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen für die Bürger der ehemaligen DDR und verlangten ihnen eine immense Anpassungsleistung ab. Zeit, sich allmählich in das Neue zu finden, wurde ihnen nicht gewährt. Eine neue Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtsordnung wurde dem Land buchstäblich über Nacht in diesem Sinne in der Tat „übergestülpt“. Die mit der deutschen Vereinigung einhergehende Marktöffnung im Jahr 1990 war in vielerlei Hinsicht mit abrupten Veränderungen für die ostdeutsche Wirtschaft verbunden. Relativ geringe Produktivität in Verbindung mit stark gestiegenen Lohnkosten trug wesentlich zu einem dramatischen Arbeitsplatzabbau in Ostdeutschland in den ersten Jahren nach dem Systemumbruch bei. Kritisch zu sehen ist die Arbeit der Treuhand. Sie ging bei der Privatisierung der Ost-Wirtschaft oft ziemlich radikal vor, machte auch Fehler und ermöglichte sogar kriminelles Handeln. Die Treuhand ist der zentrale Punkt der schockartigen Nachwendeerfahrung. Für viele Älteren ist das bis heute ein hoch emotionales Thema. Vielfach wurde ihr Wirken als Herabsetzung empfunden. Da kamen Menschen aus Westdeutschland und erklärten der Belegschaft eines Betriebes, das er ist nichts wert ist, und in vielen Fällen führte dies zu seiner Liquidation. Das hat zu millionenfachen Verwundungen geführt. Man muss aber auch sehen, dass man nach 1990 auch keine westlichen Konzerne zwingen konnte, marode Firmen zu übernehmen und Verluste zu machen, weshalb sich Betriebsübernahmen eher auf „Perlen“ konzentrierten. Die bundesdeutsche Marktwirtschaft folgte eigenen Spielregeln und nicht politischem Wunschdenken.
Ich kann den Eindruck nicht teilen, dass die Menschen in den neuen Ländern heute mit der Arbeit der Justiz „fremdeln“.
Rundblick: Der überwiegende Teil derer, die nach der friedlichen Revolution in den neuen Ländern Recht gesprochen und in den Staatsanwaltschaften ermittelt haben, waren Westdeutsche. Das war wohl unvermeidbar, weil die DDR-Justiz schwer belastet war. Aber kann das auch ein Grund dafür sein, dass bis heute viele Menschen im Osten mit dem politischen System und der Arbeit der Justiz fremdeln?
Guntau: Ich kann den Eindruck nicht teilen, dass die Menschen in den neuen Ländern heute mit der Arbeit der Justiz „fremdeln“. Sicher war die DDR-Justiz belastet in ihrer abhängigen Rolle gegenüber dem sozialistischen Staat, geprägt im Geist der marxistisch-leninistischen Rechtstheorie weniger als Kontrollorgan staatlichen und privaten Handelns, sondern vielmehr als Vollstreckungsorgan des Willens der herrschenden SED. Wer damals Erfahrungen mit der politischen Justiz der DDR gemacht hatte, wollte diesen Richtern auf keinen Fall wieder gegenüberstehen. Dies hat ja dazu geführt, dass nach der Vereinigung Deutschlands Richter und Staatsanwälte aus den alten Ländern die Justiz in den neuen Ländern aufgebaut haben. Es ist allerdings nicht zu leugnen, dass die westdeutsche Dominanz der Justiz bedenklich ist, da es vielfach an einer genauen Kenntnis der Lebensumstände in der früheren DDR fehlte. Dreißig Jahre nach dem Mauerfall sind nur rund 13 Prozent der Richter an ostdeutschen Gerichten Ostdeutsche und die amtierenden Gerichtspräsidenten sind alle erst nach der Wende in die neuen Bundesländer gekommen. Dieser Zustand wird sich allerdings in den nächsten Jahren infolge der Altersstruktur grundlegend ändern.
Es hat sich gezeigt, dass der Rechtsstaat sich schwer mit der Ahndung von Staatsrecht der DDR-Diktatur getan hat, so frustrierend das auch für überlebende Opfer und ihre Angehörigen sein mag.
Rundblick: Die Erwartungen der Bürgerrechtler in der DDR, man möge die Taten der SED-Diktatur juristisch aufarbeiten und den Tätern ihre gerechte Strafe zukommen lassen, sind bis auf bestimmte Teile – etwa die Mauerschützenprozesse – weitgehend unerfüllt geblieben. Worauf führen Sie das zurück? Gab es politische Hürden für eine Abrechnung mit der alten Diktatur?
Guntau: Die Ahndung von „Unrecht“ mit rechtsstaatlichen Mitteln ist ein sehr komplexes Angehen. Zum einen kann man spezielle Straftatbestände schaffen, die auf den allgemeinen Menschenrechten basieren, zugleich aber das zu ahndenden Unrecht zu erfassen suchen. Allerdings widerspricht dieses Vorgehen dem Rechtsstaatsprinzip, wonach Verbrechen nur angeklagt werden darf, wenn der Straftatbestand zum Zeitpunkt der Tat explizit formuliert und mit Sanktionen bedroht war. Die zweite Möglichkeit stellt auf das zum Zeitpunkt des jeweiligen Verbrechens gültige nationale Recht ab. Dieser Weg entzieht dem Vorwurf rückwirkender Bestrafung zwar den Boden. Aber er bringt andere Nachteile mit sich. So müssen oft rechtsstaatswidrig zustande gekommene Gesetze der gestürzten Diktatur angewendet werden. Ihre rechtsstaatskonforme Auslegung führt in vielen Fällen oft zu Ergebnissen zugunsten der Angeklagten, sofern sie den formalen Anforderungen der anzuwendenden Rechtsnorm genügt hatten. Bundesdeutsche Gerichte entschieden sich bei der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit für diesen Weg. Es hat sich gezeigt, dass der Rechtsstaat sich schwer mit der Ahndung von Staatsrecht der DDR-Diktatur getan hat, so frustrierend das auch für überlebende Opfer und ihre Angehörigen sein mag. Seit dem 3. Oktober 2000 sind ohnehin alle DDR-Verbrechen außer Mord im engeren Sinne verjährt.
Sicher schwinden diese Empfindungen und wächst das gemeinsame Land zusammen. Aber die Verletzungen haben in den persönlichen und familiären Schicksalen einen fest verwurzelten Platz.
Rundblick: Welches sind aus Ihrer Sicht die gravierendsten Fehler im Einigungsprozess? Warum kann man auch nach 30 Jahren noch nicht behaupten, dass Ost und West in Deutschland wirklich zu einem Volk zusammengewachsen sind?
Guntau: Ich würde nicht von „Fehlern im Einigungsprozess“ reden, für den es keine Blaupause gab, wohl aber gab es zum Teil auch gravierende Fehler in der Umsetzung des Prozesses. Dies betrifft die Umgestaltung der Wirtschaft mit der Folge von bisher in der früheren DDR unbekannter Arbeitslosigkeit dem Verlust von sozialen Vergünstigungen und Beziehungen. All dies betraf die Menschen in der alten Bundesrepublik nicht. Ihre Befürchtungen, die Kosten der Umstrukturierung durch massive Steuerhöhungen tragen zu müssen, wurde so nicht einmal Wirklichkeit. Was bleibt ist der Solidaritätszuschlag. So sehen sich viele Menschen im Osten als Verlierer und viele im Westen als Sieger. Überheblichkeit und mangelnder Respekt auf der einen und das Gefühl von Unterlegenheit auf der anderen sind die Folgen. Sicher schwinden diese Empfindungen und wächst das gemeinsame Land zusammen. Aber die Verletzungen haben in den persönlichen und familiären Schicksalen einen fest verwurzelten Platz.
Lesen Sie auch: Pro & Contra: Brauchen wir weiter den „Aufbau Ost“? 30 Jahre Wiedervereinigung: Havliza dankt Justiz
Rundblick: Was würden Sie raten, damit die menschliche Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschen in den kommenden Jahren besser klappen kann? Müssen sich beide Seiten bewegen – und, wenn ja, in welche Richtung jeweils? Guntau: Die vielfach weiter zu beobachtende Entfremdung zwischen Ost und West lässt sich vor allem auf die jahrzehntelange Teilung und den sozialen Umbruch nach der Wiedervereinigung zurückführen. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten geschah de facto nicht auf Augenhöhe, sondern es war der Beitritt eines kollabierenden deutschen Teilstaates zu einem größeren Gesamtstaat. Fast alle DDR-Bewohner wollten die Einheit, um so schnell wie möglich so wie die Westdeutschen leben zu können. Diese wiederum wollten weder den Lebensstil ihrer ostdeutschen „Brüder und Schwestern“ noch „sozialistische Errungenschaften der DDR“ übernehmen. Viele Westdeutsche rechnen sich quasi persönlich die Überlegenheit ihres Systems zu und werten gleichzeitig Ostdeutsche gemeinsam mit deren altem System ab. Der individuellen Lebensleistung aber gebührt Anerkennung, unabhängig davon, in welcher staatlichen System ein Mensch gelebt hat. Erst wenn Pauschalisierungen ausgeräumt sind, kann ein Zusammenleben ohne individuelle oder sogar kollektive Kränkungen gelingen. Die deutsche Wiedervereinigung ist und bleibt trotz aller Widrigkeiten und Probleme unter dem Strich eine Erfolgsgeschichte, auf die wir alle stolz sein dürfen. Ich bin überzeugt davon, dass es ungemein wichtig ist, den jeweils anderen Teil Deutschlands kennen zu lernen und das Gespräch mit Einheimischen zu suchen, Vorurteile und Vorverurteilungen gar nicht aufkommen zu lassen oder gar zu pflegen. Man sollte auch auf die Begriffe von „alten“ und „neuen“ Bundesländern verzichten. Wir sind ein Land.
 Rundblick: Wäre es angesichts der gegenwärtigen Legitimationskrisen, die sich etwa bei systemfeindlichen Demonstrationen rund um die Corona-Politik zeigen, sinnvoll, über eine Veränderung der politischen Entscheidungsabläufe und der Verfassung nachzudenken? In welche Richtung müsste dies geschehen?
Guntau: Ich bin nicht der Meinung, dass es einer Veränderung der politischen Entscheidungsabläufe bedarf. Wichtiger ist es, die demokratischen Rechte bei Wahlen und Abstimmungen auch tatsächlich wahrzunehmen. Demokratie ist ein Angebot an den mündigen Bürger, diese Rechte auszuüben und er sollte sich nicht in eine Zuschauerrolle zurückziehen, wenn die Demokratie nicht Schaden nehmen soll.
Rundblick: Wäre es angesichts der gegenwärtigen Legitimationskrisen, die sich etwa bei systemfeindlichen Demonstrationen rund um die Corona-Politik zeigen, sinnvoll, über eine Veränderung der politischen Entscheidungsabläufe und der Verfassung nachzudenken? In welche Richtung müsste dies geschehen?
Guntau: Ich bin nicht der Meinung, dass es einer Veränderung der politischen Entscheidungsabläufe bedarf. Wichtiger ist es, die demokratischen Rechte bei Wahlen und Abstimmungen auch tatsächlich wahrzunehmen. Demokratie ist ein Angebot an den mündigen Bürger, diese Rechte auszuüben und er sollte sich nicht in eine Zuschauerrolle zurückziehen, wenn die Demokratie nicht Schaden nehmen soll.