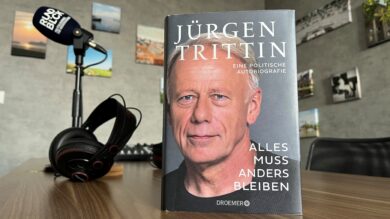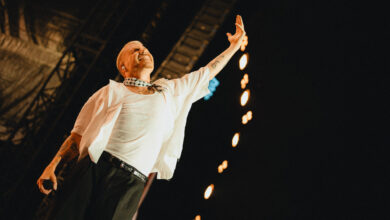Nachdem die Deutsche Bahn (DB) die Interregio-Verbindung zwischen Hamburg und Berlin eingestellt hat, ist der Ärger in Nordostniedersachsen groß. Lüneburg, Uelzen, Salzwedel (Sachsen-Anhalt) und Lüchow-Dannenberg fühlen sich abgehängt. „Die Klimawende wird nicht gelingen, wenn die Metropolen besser miteinander verknüpft werden, jedoch die Menschen in der Fläche vergessen werden“, ärgert sich Uelzens Landrat Heiko Blume in einem Brief an Bahnchef Richard Lutz.

Zusammen mit seinen Kollegen aus den drei anderen Landkreisen fordert Blume die schnellstmögliche Aufnahme des Interregio-Express, den die Bahn zum Fahrplanwechsel aus Kostengründen eingestellt hatte. Doch die Chancen auf einen Sinneswandel sind gering. Die Bahn-Pläne für Niedersachsen im Jahr 2022 machen deutlich, dass der Konzern verstärkt auf lukrative Strecken zwischen Großstädten setzt und den Regionalverkehr zunehmend vernachlässigt.
„Wenn die Landkreise als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs den Maßstab der DB an die Wirtschaftlichkeit anlegen würden, würde kaum eine Linie im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten sein. Und trotzdem fahren bei uns die Busse auch dort, wo es sich nicht rechnet. Wir Landkreise stehen zu unserer Verantwortung. Die DB sollte dieses ebenfalls tun“, heißt es im Appell von CDU-Politiker Blume.

An der Entscheidung der Aktiengesellschaft dürfte das allerdings nichts ändern. Die Bahn hatte die Einstellung der Interregio-Strecke im Oktober damit begründet, dass sich das Nahverkehrsangebot aufgrund von „Kapazitätseinschränkungen“ bis auf weiteres nicht mehr rechnet. „Mit Blick auf die Jahre 2022 und 2023 müssen wir bereits jetzt feststellen, dass auch in den kommenden zwei Jahren aufgrund umfangreicher Bauarbeiten kein durchgängig verlässliches und kundenorientiertes Angebot und damit auch kein wirtschaftlicher Betrieb des IRE Berlin-Hamburg realisierbar ist“, argumentierte die Bahn und vermeldete zwei Monate später, dass künftig noch mehr Direktverbindungen zwischen den beiden Städten verkehren werden: 60 Fahrten pro Tag im Halbstundentakt.
Die Einstellung des IRE Berlin-Hamburg wirft ein schlechtes Licht auf den aktuellen Zustand des deutschen Schienennetzes. Der Fall scheint beispielhaft für die jahrelange Vernachlässigung der Infrastruktur zu sein, bei der nun der Nahverkehr gegenüber dem lukrativeren Fernverkehr den Kürzeren zieht. „Der Schienenverkehr wächst, das Netz schrumpft“, lautet die Dauerkritik des Verbands „Allianz pro Schiene“. 1994 habe das deutsche Schienennetz noch eine Streckenlänge von 44.600 Kilometern gehabt, inzwischen sind nur 38.400 Kilometer übrig. Während das Schienennetz um 14,9 Prozent schrumpfte, ist das Fahrgastaufkommen fast um die Hälfte gewachsen. Im Jahr 2000 wurden auf den deutschen Gleisen rund 2 Milliarden Fahrgäste transportiert, 2019 waren es schon 2,931 Milliarden (plus 46,6 Prozent).

„Der Koalitionsvertrag ist zwar schienenfreundlich, lässt die notwendigen Schritte für eine Verdopplung der Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr aber bestenfalls im Ansatz erkennen“, bemängelt Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. Er fordert von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) schnell Klarheit darüber, „wie er Anspruch und Realität in Einklang bringen möchte“. Bislang hat Wissing noch nicht geliefert.
2021 hat die Bahn nach eigenen Angaben rund 12,7 Milliarden Euro für Infrastruktur ausgegeben, allerdings wurde nur 4 Milliarden vom Unternehmen selbst investiert. „Die Schiene ist ein Herzstück der Klimawende. Deshalb investieren wir so viel wie noch nie und erhöhen das Tempo für die Sanierung und mehr Kapazität im Schienennetz“, sagte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Doch während die Gesamtinvestitionen ins Schienennetz bis 2023 auf 14,4 Milliarden ansteigen sollen, sinkt der Eigenanteil der Bahn auf 3,5 Milliarden ab. Zudem fließt das Geld größtenteils in die Aufarbeitung des gewaltigen Sanierungsstaus.

Der Bahnreisende bekommt von den Rekordausgaben deswegen nur wenig mit. Der 150 Millionen Euro teure Streckenausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg, durch den die Strecke ab Ende 2023 zweigleisig sein wird, ist eine der wenigen für den Bahnreisenden spürbaren Verbesserungen. Die beiden Großstädte werden Halbstundentakt verbunden sein. Der ländliche Raum profitiert davon ebenso wenig wie vom Gleisausbau zwischen Hamburg und Berlin. Und auch der Ausbau der Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Würzburg hilft erst einmal nur dem Fernverkehr weiter. „Nach über 30 Jahren Dauerbetrieb braucht die ‚alte Dame‘ nun eine Frischekur“, heißt es dazu bei der Deutschen Bahn. 557 Kilometer Gleis, 700.000 Schwellen und eine Million Tonnen Schotter werden während der Sanierung von 2019 bis 2023 erneuert.

Bei der Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken geht Niedersachsen immerhin nicht ganz leer aus. Unter den bundesweit 20 Strecken, die nach aktuellen Plänen der Bahn wieder in den Dienst gestellt werden sollen, befindet sich auch die Verbindung Buchholz-Maschen-Hamburg. „Die Reaktivierung stillgelegter Strecken steht für das Comeback der Schiene in der Fläche und damit für einen klimafreundlicheren Verkehrsmix. Die nächste Bundesregierung ist gefordert, die Hürden für weitere Reaktivierungen zu senken“, sagt Allianz-pro-Schiene-Geschäftsführer Flege.
Niedersachsen könnte hier zukünftig durch den Kauf der OHE-Schieneninfrastruktur durch eine landeseigene Gesellschaft profitieren. „Der Landtag ist der Auffassung, dass mit der Übernahme der Strecken, die den Fortbestand der OHE-Strecken sichern sollen, perspektivisch auch eine Wiederinbetriebnahme von Strecken für den Personennahverkehr möglich ist, soweit dies wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist“, heißt es in eine Landtagsentschluss. Hohe Fahrgastpotenziale seien bereits für den Streckenabschnitt Lüneburg-Amelinghausen sowie für die Strecke Lüneburg-Bleckede ermittelt worden. Zwischen 1994 und 2020 sind in Niedersachsen laut der Allianz pro Schiene insgesamt neun Strecken reaktiviert worden, vier davon für den Personennahverkehr.
Zwischen Hannover und Bielefeld lotet die Bahn derzeit die Chancen für Gleiserweiterungen oder sogar einen Neubau aus – vielleicht entlang der Autobahn 2. Die DB Netz AG hat dabei einen 2500 Quadratkilometer großen Korridor im Blick und das Ziel, den zweigleisigen Engpass zwischen Wunstorf und Minden aufzulösen. Pendler, Fernreisende und der Güterverkehr sollen hier gleichermaßen profitieren. „Die Modell-Varianten des Bundes zeigen: Das Projekt ist machbar“, betont die DB Netz AG. Das Verfahren befindet sich derzeit in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung.