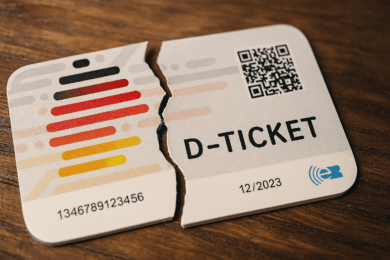Wer nicht hören will, muss fühlen: Nachdem Unternehmer und Wirtschaftsverbände seit Monaten vor einer Deindustrialisierung warnen, ziehen sich nun erste Konzerne im großen Stil aus Deutschland zurück. Mit Goodyear und Michelin haben gleich zwei Reifenhersteller drastische Maßnahmen angekündigt: Produktionsanlagen in Fulda, Fürstenwalde, Karlsruhe, Homburg und Trier werden in den nächsten Jahren geschlossen, mehr als 3000 Jobs gehen verloren. Fast die Hälfe aller deutschen Reifenwerke ist betroffen.

Auch international tätige Automobilzulieferer wie Sumitomo, GKN, Magna, Faurecia, ZF Friedrichshafen, Valeo und Continental dünnen ihre Produktion in Deutschland aus, während sie in anderen Ländern teilweise massiv investieren. In Niedersachsen bietet das Aus für das Conti-Werk in Gifhorn bis Ende 2027, wo derzeit 450 Festangestellte und ebenso viele Leiharbeiter beschäftigt sind, vermutlich nur einen Vorgeschmack auf weitere Produktionsverlagerungen.
Automotive-Vorstand Philipp von Hirschheydt will in seinem kriselnden Unternehmensbereich durch die Verschlankung der Verwaltung ab 2025 jährlich 400 Millionen Euro einsparen und dabei um die 5000 Arbeitsplätze abbauen. Nähere Details zu den Sparplänen sollen am heutigen Montag verraten werden. Bei einem Kapitalmarkttag wollen von Hirschheydt und seine Vorstandskollegen ein „umfassendes Strategie-Update“ geben.

In der deutschen Kautschukindustrie herrscht auch ohne weitere Schreckensmeldungen aus Hannover bereits Alarmstimmung. „Die prominenten Beispiele für Standortschließungen und Industrieabwanderungen der vergangenen Tage und Wochen zeigen eindringlich, dass insbesondere die energiepolitischen Rahmenbedingungen am Hochlohn-Standort Deutschland selbst innerhalb Europas nicht mehr wettbewerbsfähig sind“, sagt Michael Klein, Präsident des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (wdk).

Der Deutschland-Chef des international tätigen Kunststoffspezialisten Hutchinson warnt davor, dass auch die bisher standorttreuen Mittelständler bald dem Vorbild der Weltkonzerne folgen könnten. „Die mittelständische Kautschukindustrie hat die gleichen Standortprobleme wie die sich zurückziehenden Unternehmen. Die zwangsläufig erforderlichen Strukturanpassungen finden lediglich zeitverzögert statt“, sagt Klein. Gefährlich sei vor allem die aktuelle Abwanderung von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Dadurch ginge nicht nur Produktion, sondern auch zukunftsträchtiges Knowhow verloren.
Die Standorttreue schwindet aber nicht nur bei den Herstellern von Bereifungen, sondern auch bei den Bereiften. Das Zugpferd des Autolands Niedersachsen sendet bereits erschreckende Signale aus. „Mit vielen unserer bisherigen Strukturen, Prozesse und hohen Kosten sind wir als Marke VW nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagte Markenchef Thomas Schäfer jüngst auf einer Vollversammlung der IG-Metall-Vertrauensleute in Wolfsburg. Konzernweite „Performance Programme“ sollen die kriselnden Unternehmensbereiche wieder auf Kurs bringen, wobei das Herzstück des Autobauers die weiteste Strecke zurückzulegen hat.

Bei den Volkswagen-Modellen bleiben aktuell von 100 Euro Umsatz im Tagesgeschäft nur noch rund 3,40 Euro als Betriebsgewinn übrig (2022: 4,70 Euro). Durch Einsparungen in Höhe von zehn Milliarden Euro soll die operative Umsatzrendite für die Kernmarke Volkswagen von 3,4 auf mindestens 6,5 Prozent angehoben werden. Nur so, betonte Schäfer, könne die Marke VW ihre Zukunft aus eigener Kraft finanzieren. Beim Gesamtkonzernergebnis peilt Volkswagen langfristig eine Marge von 10 Prozent an, auch wenn in 2023 nicht einmal das Jahresziel von 7,5 Prozent erreicht wird.
Das Sparprogramm bei Volkswagen erhöht auch den Kostendruck auf die Zulieferer, die ihr Heil bereits ebenfalls in der Standortflucht suchen. „Mehr als jedes dritte Unternehmen (35 Prozent) plant inzwischen eine Investitionsverlagerung ins Ausland“, hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) in seiner aktuellen Mittelstands-Umfrage erfahren. Verlagerungsziele sind demnach andere EU-Länder, Asien und Nordamerika – in dieser Reihenfolge. Lediglich ein Prozent der Unternehmen will seine Investitionen in Deutschland erhöhen. „Momentan erleben wir den historischen Umbruch einer deutschen Schlüsselindustrie, mit allen Risiken und Nebenwirkungen – und unklarem Ausgang. Eine ganze Branche muss sich neu erfinden, allerdings unter denkbar schlechten Rahmenbedingungen“, sagt Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall.

Damit der Wirtschaftsstandort Deutschland wieder international mitmischen kann, brauche es eine „Frischzellenkur“ – von günstigen Energiepreisen und weniger Bürokratie bis hin zu einer spürbaren Reduzierung der Steuer- und Abgabelasten. „Substanz und Power sind gerade in der Automobilindustrie vorhanden, beides muss sich nur zielgerichtet entfalten können. Dazu sollte die ausufernde Subventionsparty beendet und eine gezielte Förderung begonnen werden, die mit nachvollziehbaren Zielen hinterlegt ist“, fordert der Vertreter der niedersächsischen Automotive-Industrie.
Anpassungsbedarf sieht Schmidt auch bei der Elektrofahrzeug-Strategie der Ampelkoalition: „Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von 15 Millionen zugelassenen E-Fahrzeugen bis 2030 ist realistischerweise unter den aktuellen Bedingungen nicht erreichbar.“ Die rückläufigen Zulassungszahlen würden deutlich machen, dass es für Elektrofahrzeuge derzeit keinen selbsttragenden Markt gibt. Trotzdem werde ab 2024 die E-Auto-Förderung gekürzt und das „Haushaltsdesaster“ der Bundesregierung stelle auch die Finanzierung weiterer Transformationsmaßnahmen infrage.
Schmidt: „Mit Blick auf die mangelnde Akzeptanz und Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen auf der einen und dem europaweiten Bestand von etwa 260 Millionen Verbrenner-Fahrzeugen auf der anderen Seite, sollten die Potentiale alternativer, klimafreundlicher Antriebstechnologien ernsthaft verfolgt und zum Einsatz gebracht werden. Andernfalls wird unsere Leitindustrie durch die Transformation irreparablen Schaden nehmen.“