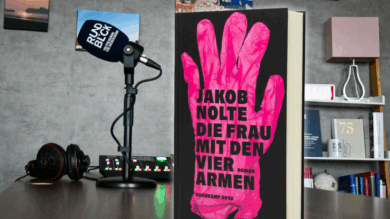Der 16. Dezember 2024 dürfte in die Landtagsgeschichte eingehen - obwohl dieser regennasse und graue Tag doch ganz unspektakulär begonnen hat. Der Staatsgerichtshof in Niedersachsen, das höchste Gericht des Landes, hatte zu einer Verkündung eingeladen - doch nur wenige Zuschauer erschienen am Morgen im großen Saal des Landgerichts in Bückeburg. Darunter waren Landeswahlleiterin Ulrike Sachs und ihr Nachfolger Markus Steinmetz, einige Juristen der Staatskanzlei und des Landtags, außerdem drei Journalisten. Die Entscheidung, die Gerichtspräsident Wilhelm Mestwerdt dann verkündete, ist für landespolitische Verhältnisse in Niedersachsen allerdings schon revolutionär: Ein Teil des Landeswahlgesetzes, nämlich die Einteilung der Landtagswahlkreise, verstößt gegen die Verfassung. Der Landtag muss die Wahlkreise jetzt so neu zuschneiden, dass zur Landtagswahl 2027 neue Grenzen verbindlich sind. Das jedoch kommt einer Quadratur eines Kreises gleich, die auch noch in größter Eile geschehen muss. Im März 2026 nämlich dürfen die Parteien mit den Vorbereitungen für die Kandidatenaufstellung beginnen. Es bleibt also nur das Jahr 2025 für die Aktion.
Derjenige, der die Sache ins Rollen gebracht hat, sitzt derweil daheim in Sögel (Kreis Emsland) und erfährt kurz nach Mestwerdts Erklärung telefonisch von seinem Sieg. Hermann Gerdes, pensionierter Gemeindedirektor in Bösel (Kreis Cloppenburg), hatte nach der Landtagswahl auf einen Missstand aufmerksam gemacht. Er fand erst kein Gehör, ließ aber nicht locker - und reichte einen Einspruch gegen die Landtagswahl vom 9. Oktober 2022 ein. Die Chancengleichheit der Wahl sei nicht gegeben, monierte er, da die Größen der Wahlkreise erheblich voneinander abweichen. Im Vergleich der Region Emsland-Grafschaft Bentheim und Göttingen-Hildesheim-Soltau falle auf, dass sich die jeweils etwa gleiche Anzahl von Wahlberechtigten auf nur vier Wahlkreise im Westen und sechs im Südosten verteile. Es gebe also ein Südost-Übergewicht bei den Direktmandaten im Landtag, während die Gebiete mit Bevölkerungswachstum im Nordwesten unterrepräsentiert seien. Seit Jahren lasse der Landtag, anderslautenden Vorschlägen der Landeswahlleiterin zum Trotz, diesen Missstand bis auf winzige Korrekturen unverändert.

Der Wahlprüfungsausschuss des Landtags verwarf Gerdes' Beschwerde, aber dieser ließ sich nicht beirren und zog nach Bückeburg. Was er hier jetzt mit dem am 16. Dezember verkündeten Urteil erlebt, kann als voller Erfolg bezeichnet werden. Der Staatsgerichtshof folgt in weiten Teilen der Argumentation von Gerdes und hält sogar den wesentlichen Teil des Landeswahlgesetzes für unvereinbar mit der Verfassung. Er erklärt nur deshalb die Landtagswahl nicht für ungültig, weil die Folgen wohl das politische System überfordern würden: Es müsste dann binnen kürzester Frist eine neue Wahlkreiskarte gezeichnet und im Landtag beschlossen werden, dann müssten auf dieser Basis rasch neue Kandidaten aufgestellt werden - und dies wäre ein gewaltiger Kraftakt, bei dem dann Sorgfalt auf Kosten der Eile ginge. Außerdem gebe es ja "den Bestandsschutz der gewählten Volksvertretung", der einer solchen Ungültigkeit der Landtagswahl im Wege stünde. Man kann also sagen: Fast hätte Gerdes' Einspruch sogar dazu geführt, dass der Staatsgerichtshof eine Wiederholung der Landtagswahl festlegt.
Woran krankt nun das bisherige niedersächsische Modell? Im Landtag gibt es eine Mindestzahl von 135 Abgeordneten, und 87 davon werden über die Erststimmen - also in den Wahlkreisen - bestimmt. Maßgeblich für die Sitzverteilung sind die Zweitstimmen, und wenn eine Partei mehr Direktmandate erringt als ihr laut Zweitstimmen zustehen, gibt es Überhang- und Ausgleichsmandate. Dieses Ausgleichssystem, das die Sitzverteilung nach Zweitstimmen wieder herstellen soll, gilt jedoch im Landtagswahlrecht nur eingeschränkt. Mit anderen Worten: Das Wahlrecht zur Landtagswahl in Niedersachsen ist sehr stark von den Erststimmen geprägt, 66 Prozent der Mandate fußen auf diesem Wahlakt für die Wahlkreise. Nun gibt es bisher die Regel, dass bei einer Abweichung der Wahlberechtigten-Zahl eines Wahlkreises von mehr als 25 Prozent gegenüber dem Durchschnittswert die Landeswahlleiterin dem Landtag einen Reformvorschlag unterbreiten muss. Weitere Festlegungen, wie der Landtag mit solchen Vorschlägen umzugehen hat, gibt es bisher nicht. Das wird jetzt mit dem aktuellen Urteil des Staatsgerichtshofs anders.

Bei der Wahl 2022 lag der erst geschaffene Wahlkreis Lüneburg-Land um 25,3 Prozent unter dem Durchschnitt, der Wahlkreis Aurich um 25,9 Prozent darüber. Beides hätte man mit kleineren Verschiebungen relativ einfach ändern können - doch der Landtag verzichtete darauf, als die Große Koalition sich Ende 2021 auf den Neuzuschnitt der Wahlkreise verständigte. Auf die eigentlich naheliegende Variante, im Westen des Landes einen neuen Wahlkreis zu schaffen, verzichtete man seinerzeit - sondern schuf in Lüneburg einen zweiten und löste dafür im Harz einen auf. Vermutlich hatte sich das Parlament relativ frei gefühlt, da die rechtlichen Vorgaben in dieser Frage bisher noch relativ locker waren. Doch das ändert sich allmählich. Der Bundestag hat für die Zeit nach 2026 beschlossen, dass bei einer Abweichung von mehr als 15 Prozent die Wahlkreise neu geordnet werden müssen. Das geht auch auf eine Empfehlung der "Venedig-Kommission" zurück, die im Auftrag der EU-Kommission tätig war und strengere Regeln angemahnt hat.
Nun ist der Staatsgerichtshof nicht so mutig, die 15-Prozent-Regel schon für das Landtagswahlrecht als verbindlich zu verordnen. Die Richter erwähnen in ihrem Urteil nur - wie bisher -, dass eine 25-Prozent-Abweichung die absolute Obergrenze sei. Und diese wurde ja auch bei der Wahl 2022 in zwei Wahlkreisen überschritten. Aber der Staatsgerichtshof hat auch festgestellt, dass es bei der Landtagswahl 2022 immerhin 30 der 87 niedersächsischen Landtagswahlkreise gab, bei denen die Zahl der Wahlberechtigten um mehr als 15 Prozent nach oben oder unten abgewichen ist, also rund ein Drittel aller Wahlkreise. An dieser Stelle kommt nun aus Bückeburg eine deutliche Ansage: Abweichungen zwischen 15 und 25 Prozent seien "nur in besonderen Ausnahmefällen zu rechtfertigen". Dass aber jeder dritte Wahlkreis unter eine solche Ausnahme verbucht werden kann, wie es 2022 geschah, verbietet das höchste Gericht des Landes: "Bei einer solch hohen Zahl von Abweichungen kann nicht mehr von Ausnahmefällen gesprochen werden." Zwar schweigt er zu der Frage, welche Anzahl er als Maximum ansieht, spricht nur von "zahlenmäßig wenigen". Aber die Richter nennen Bedingungen: Wenn historische Verwaltungs- und Gemeindegrenzen nicht zerschnitten werden sollen, wenn es um "infrastrukturelle Barrieren" geht (etwa bei Inseln), oder wenn man landsmannschaftliche Zugehörigkeiten beachten müsse, könne man ausnahmsweise um mehr als 15 Prozent den Durchschnitt über- oder unterschreiten. Nicht geschehen dürfe dies, wenn es das Ziel sei, "Erbhöfe etablierter Abgeordneter zu sichern".
In dem Urteil taucht noch ein interessanter Hinweis der Richter auf. Sie beschreiben die Tatsache, dass ein bestimmter Durchschnittswert der Wahlberechtigten-Zahl umso schwerer einzuhalten ist, je kleiner die Wahlkreise begrenzt sind, je mehr Wahlkreise es also gibt. Da es ja Ziel sei, Gemeindegrenzen möglichst nicht zu zerschneiden, könne das Verlagern einzelner Gemeinden von einem zum anderen Wahlkreis rasch die Durchschnittswerte sprengen. Aber braucht Niedersachsen überhaupt 87 Wahlkreise? Im Urteil heißt es, diese Zahl sei "hoch" - und aus der Schilderung folgt, dass man etwa mit 80 Wahlkreisen ein besseres Modell entwickeln könnte, annähernd gleichgroße Wahlkreise auf das Land zu verteilen. In diesem Fall müsste jedoch vermutlich jeder der bisher 87 Wahlkreise verändert werden, und es stünde von vornherein fest, dass mindestens sieben der 87 direkt gewählten Abgeordneten nicht in den nächsten Landtag zurückkehren könnten. Ob die Fraktionen im Landtag den Mut hätten, mit einer solchen Ansage in den Reformprozess zu starten?
Dieses Detail zeigt, welche Herkulesaufgabe die Richter des Staatsgerichtshofs kurz vor Weihnachten den Landtagsabgeordneten auf den Gabentisch gelegt haben. In den Fraktionen dürfte jetzt ein eifriges Rechnen und Zeichnen beginnen - immer mit dem Ziel, völlig neue Wahlkreise zu schneiden und dabei möglichst auch das politische Kalkül nicht außer acht zu lassen. Anhand von bisherigen Wahlergebnissen lässt sich immer gut ermessen, welcher Wahlkreis mit leichten Veränderungen des Gebietszuschnitts stärker als "rot", "schwarz" oder "grün" eingestuft werden kann. Die Große Koalition zwischen 2017 und 2022 war an der Aufgabe, dafür eine passende Antwort zu finden, kläglich gescheitert. Das haben die Bückeburger Richter jetzt förmlich bescheinigt. Der erste, der sich jetzt mit den Folgen dieses Richterspruchs auseinandersetzen muss, wird der neue Landeswahlleiter Markus Steinmetz sein. Er dürfte demnächst dem Landtag einen Bericht zu den Auswirkungen des Urteils vorlegen.
Hermann Gerdes, der an diesem Tag unsichtbare Sieger von Bückeburg, gibt sich unterdessen mit seinem Erfolg nicht zufrieden. Er meint, dass die Lösung der Aufgabe, die den Abgeordneten übertragen wurde, vermutlich ohne eine kräftige Verringerung der Zahl der Wahlkreise nicht zu meistern sein wird. Ein Modell dazu, wie es in einzelnen Regionen des Landes aussehen könnte, hat Gerdes schon im Kopf. Bisher war er damit bei den Fraktionen des Landtags wenig gefragt. Vielleicht wird das jetzt anders sein. Es kommt nicht oft vor, dass ein engagierter Bürger mit einem Hinweis auf einen rechtlichen Missstand so viel Erfolg vor Gericht erwirkt wie jetzt dieser frühere Gemeindedirektor. Wäre er am Montag in Bückeburg erschienen, worauf er gesundheitsbedingt verzichtet hat, hätte man dort sein Engagement bestimmt gewürdigt.