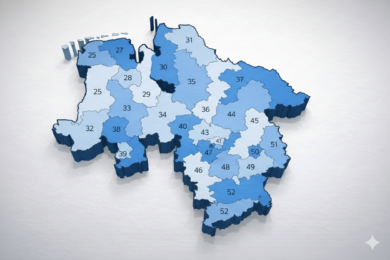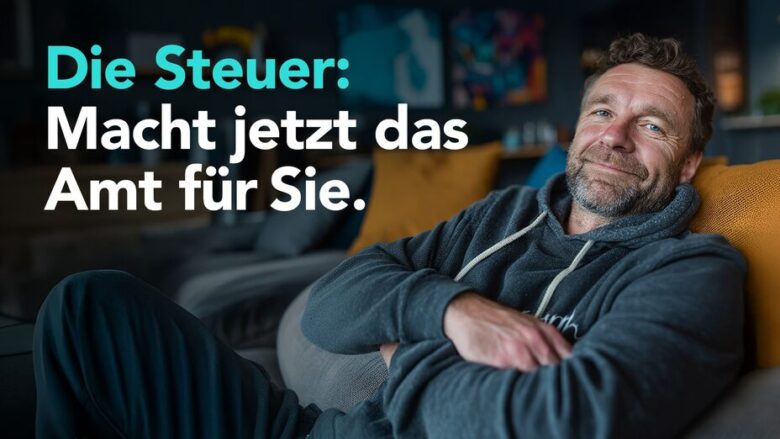
Die CDU/SPD-Koalition in Hessen schreitet mutig voran: Dort sollen künftig diejenigen Steuerbürger, die ihre Steuererklärung in der vorgegebenen Frist nicht abgegeben haben, einen besonderen Service des Staates bekommen – die Finanzämter schicken ihnen ihre Schätzung zu und bitten die Bürger, das als „korrekt“ zu bestätigen. Ist das ein sinnvolles Modell für die Zukunft? Die Rundblick-Redaktion streitet darüber in einem Pro und Contra.
PRO: Wenn der Staat sowieso schon alle Daten hat, sollte er sie auch nutzen. Warum Millionen Menschen jedes Jahr den Finanzämtern Informationen mitteilen, die dort schon längst vorliegen müssten, bleibt ein bürokratisches Rätsel. Als erstes Bundesland zeigt Hessen mit seiner Weiterentwicklung der vorausgefüllten Steuererklärung den Weg raus aus der Formularhölle und bringt Niedersachsen in Zugzwang, meint Christian Wilhelm Link.
„Die Steuer macht jetzt das Amt“ – das klingt wie ein Versprechen und eine Drohung zugleich. Doch was in Hessen gerade getestet wird, ist nichts Geringeres als ein Befreiungsschlag für Bürger. Denn machen wir uns nichts vor: Steuererklärungen sind in den meisten Fällen eigentlich nur Abschreibübungen der nervigsten Sorte und ähneln einem staatlich verordneten Sudoku-Kurs, bei dem das Finanzamt sowieso schon die Lösung kennt, aber wissen will, ob wir sie auch ins richtige Feld eingetragen haben.

Dabei ist das Risiko hoch und der Gewinn durch die Einkommensteuerrückzahlung für den Durchschnittsbürger überschaubar. Wer sich bei der Erklärung einmal vertut, landet schnell auf dem Radar des Finanzamts. Eine falsch interpretierte Zeile, ein übersehener Haken – und schon werden zusätzliche Nachweise gefordert oder sogar Vorauszahlungen fällig. Für Selbstständige oder Freiberufler reicht ein kleiner Rechenfehler, um monatelang mit dem Amt diskutieren zu müssen. Und das alles in einem System, das so unübersichtlich ist, dass selbst Steuerprofis manchmal nur ratlos mit den Schultern zucken können.
Das hessische Modell dreht diese Schieflage um: Das Amt macht den ersten Schritt. Es erstellt einen Vorschlag, der innerhalb von vier Wochen geprüft oder geändert werden kann. Wer will, kann also selbst nachrechnen, alle anderen profitieren von der Automatisierung. Im hochkomplexen deutschen Steuersystem müsste das eigentlich der Standard sein und nicht die Ausnahme. Darüber hinaus sollte sich das alles nicht nur – wie im hessischen Modellprojekt – auf erklärungspflichtige Bürger beschränken, sondern für alle gelten, die Einkommensteuer zahlen. Viele, die gar keine Erklärung abgeben müssen, verschenken jedes Jahr Geld, weil sie sich vor den Formularen fürchten. Wenn das Finanzamt schon einmal rechnet, könnte es gerechterweise auch diesen Menschen helfen.
Macht es das neue System einfacher, den Staat zu betrügen? Möglicherweise. Steuerhinterziehung entsteht aber nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Vorsatz. Wer Einnahmen verbergen will, tut das längst, ganz gleich ob er die Zahlen selbst einträgt oder sie vorgeschlagen bekommt. Übertriebene Bürokratie hat noch niemanden ehrlicher gemacht. Automatisierung und Kontrolle müssen deshalb Hand in Hand gehen. Stichprobenprüfungen und empfindliche Strafen bei vorsätzlichem Betrug gehören dazu, wenn das Serviceangebot nicht zur Einladung zum Missbrauch werden soll. Dann ist die automatische Steuererklärung auch keine Erleichterung vor allem für Trickser, sondern eine Entlastung für die Mehrheit – und ein Schritt, den Niedersachsen auf keinen Fall verpassen sollte.
CONTRA: Jede Vereinfachung im Steuerrecht ist erst einmal sinnvoll – auch und gerade bei den Steuererklärungen, die jedes Jahr kompliziert ausfallen. Der Staat darf aber die ureigenen Pflichten jedes Staatsbürgers nicht aushebeln. Diese Gefahr besteht aber im hessischen Modell, meint Klaus Wallbaum.
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder gute Fortschritte gegeben bei dem leidigen Thema der Steuererklärungen. Daten zum Verdienst und zu den Sozialabgaben, die früher mühsam aus amtlichen Unterlagen herausgezogen und handschriftlich in die Vordrucke eingetragen werden mussten, werden inzwischen automatisch übermittelt – von Behörde zu Behörde. Das ist eine Entlastung, aber einfacher wird die Steuererklärung dadurch noch immer nicht.
Der Reiz, der mit dem hessischen Modell einhergeht, liegt auf der Hand: Arbeitnehmer, Selbstständige, Unternehmer oder auch Rentner bekommen eine Hilfestellung, die sie dankbar annehmen dürften. Denn in sehr vielen Fällen ist eine Steuererklärung nur eine umständliche Pflicht, da die Angaben des Steuerbürgers sowieso dem entsprechen, was die Finanzbehörden an Vorinformationen schon gespeichert haben. Es gibt sehr oft also gar nichts mehr „zu erklären“, denn viele Daten liegen (auch aus den Vorjahren) längst vor. Trotzdem ist der hessische Weg riskant und sollte nicht zur Wiederholung empfohlen werden. So sinnvoll es ist, komplizierte Behördenvorgänge zu vereinfachen, zu digitalisieren und einzudampfen, so sehr muss man doch auch darauf achten, um welche Vorgänge es geht. Steuererklärungen sind eben nicht vergleichbar mit Anträgen auf Sozialleistungen oder für die Ausstellung neuer Pass-Papiere.

Mit der Steuererklärung offenbart der Bürger seine Einnahmen, für die er dem Staat eine Abgabe schuldet. Die dann folgenden Zahlungen sollen in der Summe aller Steuerpflichtigen die wesentliche finanzielle Basis für die Dienste des Staates sein, die dieser zum Schutz und zur Unterstützung der Bürger leistet. Es geht um die innere und äußere Sicherheit, um die Infrastruktur, um die Sicherung von Mobilität, Bildung und sozialen Ausgleich. Diese Erklärung des Steuerpflichtigen gegenüber dem Staat ist damit ein besonderer staatsbürgerlicher Akt – vergleichbar vielleicht mit der Ausübung des Wahlrechts oder auch der Übernahme eines besonderen Ehrenamtes, beispielsweise eines Schöffenamtes am Gericht. Auch die Wehrpflicht, wenn sie denn wiederkehren sollte, gehört in diese Kategorie.
Das Problem des hessischen Modells ist folgendes: Die Autorenschaft für die Steuererklärung, die Hoheit über die Angaben, geht weitgehend vom Steuerpflichtigen auf das Finanzamt (also den Empfänger der Zahlung) über. Wenn der Steuerbürger die vorab von der Behörde ausgefüllte Unterlage nur noch mit einem Häkchen und einer Unterschrift absegnen soll, geht damit wenigstens teilweise eine Delegation der Verantwortung für die Inhalte an das Finanzamt über. Das kann die Versuchung vergrößern, solche Einnahmen dem Finanzamt zu verschweigen, auf die diese Behörde nicht vorher schon gestoßen ist und die versteuert werden müssten. Solange der Bürger immer noch selbst gezwungen ist, sämtliche Angaben selbst aufzulisten und anzugeben, dürfte diese Versuchung zum Verschweigen wichtiger Einnahmen geringer ausgeprägt sein. Insofern verleitet der hessische Weg zur Unwahrhaftigkeit.
So sinnvoll Vereinfachungen und Pauschalisierungen im Steuerrecht auch sind – diese dürfen nicht dazu führen, dass den Steuerpflichtigen Brücken zum Steuerbetrug gebaut werden. Daher sind Vorsicht und Zurückhaltung geraten.