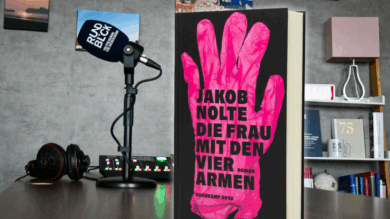Die Corona-Pandemie hat die Angst vor Krankheiten, die von fremden Tieren ins Land eingeschleppt und schließlich auf den Menschen übertragen werden könnten, stark befeuert. Manch einer versteht die Pandemie als Warnschuss der Natur: Wildnis und Mensch brauchen etwas mehr Abstand.

Doch Krankheiten sind gar nicht das einzige und nicht das vordringlichste Problem, das wilde Tiere in privaten Haushalten verursachen können. Angriffe, Ausbrüche und hohe Folgekosten bei langlebigen Tierarten sowie eine Überforderung der klassischen Tierheime beunruhigen die Politik. Der Landtag befasst sich deshalb derzeit mit der Frage, wie der Handel mit exotischen Tieren besser reguliert und die Haltung besser überwacht werden kann. Folgende Aspekte werden dabei diskutiert:
Rund 15 Millionen Hundebesitzer gibt es in Deutschland. Das zumindest weiß man noch ziemlich genau, weil die Tiere bei den Behörden angemeldet werden müssen. Schon bei Katzen sieht das anders aus, da geht man von knapp 10 Millionen Besitzern bundesweit aus. Exotische Tiere hingegen vermutet man bei etwa fünf Millionen Menschen – und kommt dabei hochgerechnet auf etwa 27 Millionen Tiere. Das vermutet zumindest Kathrin Glaw vom „Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde“, die im Agrarausschuss des Landtags als Expertin gesprochen hat. Eine Statistik zu „gebietsfremde Tierarten“, die privat gehalten werden, gibt es bislang nicht. Einen Herkunftsnachweis braucht man nur bei streng geschützten Arten.
Glaw hält allerdings nichts von einer derartigen Registrierung – zumindest sollte sie nicht allzu streng ausfallen, meint die Züchterin exotischer Tierarten. Um die Forderung ad absurdum zu führen, verwies sie beispielsweise auf Seepferdchen oder Frösche, deren Nachkommen in einem Wurf so zahlreich seien, dass sie sich gar nicht so einfach registrieren ließen. Zudem werde die Meldung dann recht schnell wieder obsolet, weil nicht aus jedem Ei eine Kaulquappe und nicht aus jeder Kaulquappe auch ein Frosch wird. Die Sterblichkeit sei eben hoch.
Doch spricht das schon gegen ein Register für wilde Tiere? Eine maßvolle Begrenzung könnte einen Mittelweg aufzeigen. Dieter Ruhnke vom Landestierschutzverband Niedersachsen warb im Agrarausschuss nachdrücklich für eine Melde- und Registrierungspflicht. Diese könnte analog zum Hunderegister aufgebaut werden und neben der reinen Information auch eine Steuerungsfunktion übernehmen: Wie bei der Hundesteuer kann eine Kommune auf diesem Weg Interessierten unattraktiver machen, sich ein exotisches Tier zuzulegen.
Aus dem Rundblick-Archiv:
Kommt nach dem Hundeführerschein bald der Schlangen-Pass?
Wenn alle exotischen Tiere ordentlich gemeldet werden müssen, ergibt sich daraus auch die Möglichkeit, Gelder von den Besitzern einzuziehen. Dies geschehe dann natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern um mögliche Kosten zu decken, die durch die Tiere verursacht werden können. Solche Kosten treten vor allem dann auf, wenn Besitzer sich leichtfertig für ein neues Haustier entschieden haben, dann überfordert sind und das Tier aussetzen oder es ihnen entwischt. Dann muss der Staat eingreifen und das Tier auflesen. Die meisten Tierheime sind dann aber nicht in der Lage, die besonderen Haltungsanforderungen zu erfüllen.
Eine andere Situation, in der der Staat plötzlich die Verantwortung für ein Wildtier übernehmen muss, tritt mit dem Tod des Besitzers ein. Gerade die beliebten Schildkröten oder Papageien haben eine sehr viel höhere Lebenserwartung als der Mensch. Nicht immer ist klar geregelt, wer sich um das extravagante Haustier eines Menschen kümmert, wenn dieser abtritt. Für einen solchen Fall schlugen die Experten im Agrarausschuss des Landtags auch eine Art Vorsorgekasse vor. Die Halter der Tiere wären dann dazu verpflichtet, Geld für den Fall der Fälle zurückzulegen. Der Staat könnte dann darauf zugreifen, wenn die Notsituation eingetreten ist. Es wäre aber keine Steuer oder Abgabe nötig, die ohnehin nicht zielgerichtet für die Pflege der Geschöpfe eingesetzt werden könnte.
Eine verpflichtende Schulung gibt es bislang noch nicht für die Besitzer exotischer Tiere. Experten raten aber dazu, diese einzuführen und bundeseinheitlich auszugestalten. In ein oder zwei Tagen könnten angehende Exoten-Halter dann die wichtigsten Grundregeln erlenen. Etwa wie die Terrarien oder Käfige ausgestaltet sein sollten, was die Tiere fressen, wie man Krankheiten erkennt und wie man die Behausungen der Echsen, Vögel oder Spinnen am sichersten für alle Beteiligten reinigen kann.
Prof. Michael Fehr von der Tierärztlichen Hochschule Hannover sagte im Agrarausschuss, zehn bis zwanzig Prozent seiner tierischen Patienten kämen aufgrund von Haltungsschäden zu ihm. Florian Brandes, Leiter der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen, erläuterte, dass die Beratungspflicht durch den Zoohandel die Sachkunde der Tierbesitzer nicht nachhaltig verbessert habe – auch er fordert daher einen Sachkundenachweis.
In diesem Punkt stimmen auch die Vertreter vom „Verband deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde“ (VDA) und von der „Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde“ (DGHT) und mit den anderen Experten überein: An der Sachkunde der Tierhalter muss dringend gearbeitet werden. Die VDA/DGHT bietet derartige Sachkundeschulungen und -nachweise für ihre Mitglieder an.
Offenbar lässt die aktuell gültige Gefahrtierverordnung eine bemerkenswerte Lücke. Der Handel ist von den Regelungen, die für Privatpersonen gelten, bislang ausgeschlossen. Brandes forderte im Agrarausschuss deshalb, diese Lücke zu schließen und die Regeln ebenso auf den Zoohandel anzuwenden. Es dürfe nicht sein, dass in Verkaufsräumen offene oder unverschlossene Terrarien mit gefährlichen Tieren stehen dürfen. Zudem wird im Landtag aber auch im Bundestag und auf EU-Ebene überlegt, wie der internationale Handel mit wilden Tieren besser begrenzt und kontrolliert werden könne.

Dabei raten die Experten, sich nicht am US-amerikanischen Gesetz zu orientieren. Dort hat man sich überlegt, den Import all jener Tierarten zu verbieten, die im exportierenden Land besonders geschützt oder als gefährlich deklariert sind. Damit wurde die Zuständigkeit ein Stück weit abgegeben und man entledigte sich der Auseinandersetzung mit der Vielfalt exotischer Tiere. Das Vorgehen führte in der Vergangenheit jedoch dazu, dass exotische Tiere vermehrt beispielsweise über Deutschland gehandelt wurden – so konnten sie aus dem Herkunftsland hierher exportiert werden, wurden dann durch deutsches Recht quasi legalisiert und gelangten so in die USA.
Ein weiteres Problem dieser Regelung ist die praktische Umsetzung. Ein solches Vorgehen würde voraussetzen, dass die exportierenden Staaten in dauerhaftem Austausch mit den Zollbehörden stünden, um über die neuesten Bestimmungen und die verschiedenen Tierarten zu informieren.
27 Millionen Exoten mag es im Land geben, aber dahinter verbergen sich nicht ausschließlich Schlangen oder Echsen. Theoretisch zählt auch jeder Goldfisch zu den exotischen Tieren – denn in der freien Wildbahn sind die in Deutschland nicht anzufinden. Zumindest Kathrin Glaw vom Aquarier-Verband nimmt das als Beleg dafür, dass eine definitorische Trennung, welches Tier nun als Exot zu werten und demnach zu reglementieren ist, höchst schwierig werden könnte.
Während Glaw eher dafür warb, weniger Tiere als Exoten zu brandmarken, sprach sich Brandes von der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen im Agrarausschuss sogar für eine Ausweitung aus. Er plädierte dafür ganz allgemein von „Wildtierhaltung“ zu sprechen und Exotenhaltung nicht von Wildtierhaltung zu trennen. Die Probleme seien dieselben, eine Abgrenzung meist nicht einfach. Als Beispiele zog er Wasserschildkröten, die gerne in heimischen Gartenteichen gehalten werden, oder die Rostgans heran und fragte: „Ist die noch Exot oder schon heimisch?“
Von Niklas Kleinwächter