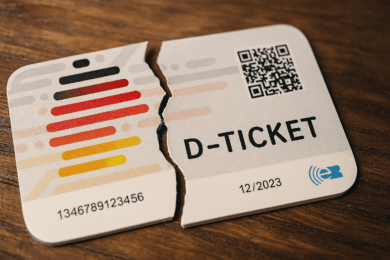Der Traum vom Geisterauto wird wahr: Schon übernächstes Jahr will die VW-Tochter Moia die ersten autonom fahrenden Shuttles vom Typ „ID.Buzz AD“ im kommerziellen Betrieb durch Hamburg rollen lassen. Der Elektro-Bulli soll mithilfe von Laserscanner (Lidar), Radar und Kamerasystem seine Umgebung vollautomatisch erfassen und durch eine künstliche Intelligenz auswerten lassen, wodurch ein menschlicher Fahrer überflüssig wird.

Doch die Ankündigung des Mobilitätsdienstleisters ist mit Vorsicht zu genießen, denn dass sich ein Robotertaxi ohne Mithilfe von außen wie ein ganz normaler Verkehrsteilnehmer über vielbefahrene Straßenkreuzungen bewegt, können sich Mobilitätsforscher aus Braunschweig derzeit kaum vorstellen. „Ganz alleine wird’s das Fahrzeug nicht können, wir brauchen auch die dazugehörige Infrastruktur“, sagte Prof. Roman Henze vom Institut für Fahrzeugtechnik (IfF) der TU Braunschweig kürzlich bei einer Fachtagung in der Löwenstadt.

Und auch Prof. Michael Ortgiese vom benachbarten Institut für Verkehrssystemtechnik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betonte: „Wir müssen jetzt in Infrastruktur investieren, um ein neues Mobilitätssystem aufzubauen. Die letzten 100 Jahre haben sich Auto und Infrastruktur völlig unabhängig voneinander entwickelt. Um das autonome Fahrzeug zum Laufen zu bringen, müssen wir aber alle gemeinsam an einer Vision arbeiten.“

Dabei kommt auch den Kommunen eine wichtige Aufgabe zu: Sie müssen ihre Verkehrsinfrastruktur in den kommenden Jahren komplett überarbeiten und den autonomen Verkehr regulieren – allein schon aus Eigeninteresse. Laut einer Studie der Beratungsfirma Deloitte wird das autonome Fahren die urbane Mobilität bis zum Jahr 2035 nämlich gravierend verändern. Die Mobilitätsexperten gehen davon aus, dass autonome Taxi- und Shuttlefahrten deutlich günstiger sein werden als Fahrten mit Privatautos oder dem öffentlichen Nahverkehr.
Eine Shuttlefahrt über zehn Kilometer wird demnach nur etwa 1,50 Euro kosten, was gut die Hälfte eines durchschnittlichen ÖPNV-Tickets wäre. Die Folge: Bereits 2035 gibt es laut Deloitte-Studie zwar 20 Prozent weniger Fahrzeuge, aber 30 Prozent mehr Verkehr und zehn Prozent mehr Staus in den Städten. „Städte sollten deshalb schon heute Konzepte erarbeiten, wie sich autonome, elektrisch betriebene Fahrzeuge und Fahrdienste bestmöglich in den Stadtverkehr integrieren lassen“, empfehlen die Autoren.
Eine Vorbildfunktion könnte dabei Berlin einnehmen, wo bereits seit 2015 verschiedene Modellprojekte mit autonomen Fahrzeugen laufen. Die Erfahrungen sind aber nicht durchweg positiv. Anstatt den Testbetrieb auszuweiten, werden die Modelprojekte in den weniger verkehrsbelasteten Nordwesten der Stadt verlagert. Das jüngste Projekt findet sogar auf dem ehemaligen Flughafen Tegel statt. „Warum gehen wir wieder weg von der Straße? Weil die Fahrzeuge einfach noch nicht so weit sind“, sagte Mélanie Jachtner, Referatsleiterin für Digitalisierung im Verkehr und Verkehrstechnik bei der Berliner Senatsverwaltung.

In einer Großstadt würden vereinzelte Robotertaxis mit einem Fassungsvermögen von gerade mal sechs Personen keinen nennenswerten „Mehrwert für die Stadtgesellschaft“ bieten. Die Erfahrungen aus Berlin zeigen außerdem: Vernetzung ist eine wichtige Voraussetzung für das automatisierte Fahren. Hier komme eine Kommune aber schnell an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
Schon die Pflege der Bestandskarte, mit deren Hilfe die Fahrzeuge in der Stadt navigieren, ist laut Jachtner eine gewaltige Herausforderung. „Diese Karte ist mindestens nach drei Monaten schon wieder um fünf Prozent fehlerhaft“, berichtete sie. Ganz ohne Karte gehe es aber auch nicht, weil nach einem typischen Wochenende in Berlin zahlreiche Schilder fehlen, die die Fahrzeuge also auch nicht scannen können.

Die größte Herausforderung aber seien unübersichtliche Verkehrskreuzungen. Von den insgesamt 25.000 Lichtsignalanlagen in Berlin seien bislang nur 26 Stück mit sogenannten Roadside Units (RSU) ausgestattet worden. Das sind Funkmodule, die für den Datenaustausch zwischen Fahrzeug, Infrastruktur und Verkehrszentrale genutzt werden. Mit Blick auf die bisherige Wartungsgeschwindigkeit der Ampelanlagen würde eine flächendeckende Umrüstung etwa 20 Jahre dauern.
Die Antwort aus Berlin auf die Forderung nach „schlauer“ Infrastruktur im öffentlichen Bereich, die autonomes Fahren unterstützen kann, fällt daher eindeutig aus. „Aufbau, Betrieb und Wartung von entsprechender Technik würde die Kommunen überfordern. Es muss möglichst viel in den Fahrzeugen drin sein“, sagte Jachtner.