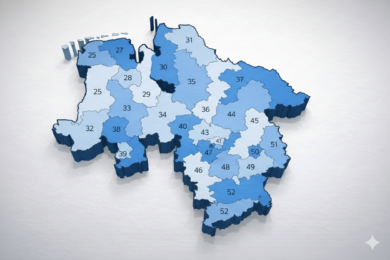Die Energiewende tritt in Niedersachsen in eine neue Phase. Während in den vergangenen Jahren vor allem vom „Redispatch“ die Rede war, geht es inzwischen um Begriffe wie Netzüberbauung, Flexibilisierung und die Synchronisierung von Erzeugung und Netzausbau. Matthias Boxberger, Vorstandsvorsitzender des Netzbetreibers Avacon, erklärt im Gespräch mit dem Politikjournal Rundblick, wo er die größten Herausforderungen sieht – und warum Niedersachsen aufpassen muss, nicht nur Energieexportland zu werden.

Rundblick: Die Energiewende in Niedersachsen hat zuletzt stark an Tempo gewonnen – zugleich wächst die Kritik an Engpässen und steigenden Kosten. Stehen wir damit an einem Wendepunkt?
Boxberger: Ja, ganz klar. Wir haben die erste Phase der Energiewende hinter uns, die im Kern eine reine Stromwende war: Möglichst viel grünen Strom ins Netz bringen und so fossile Kraftwerke verdrängen. Das war erfolgreich – in unserem Netzgebiet wird inzwischen mehr als doppelt so viel Strom eingespeist, wie tatsächlich verbraucht wird. Aber diese erste Etappe war vergleichsweise einfach, weil es nur darum ging, Erzeugung hochzufahren. Die nächste Phase ist ungleich schwieriger: Wir müssen Erzeugung, Verbrauch und Netzausbau synchronisieren. Das heißt, wir reden nicht mehr nur über Windräder und Solarmodule, sondern über Wärmewende, Mobilität, Speicherkapazitäten und Netzinfrastruktur. Erst wenn all das zusammenpasst, kann man von einer echten Energiewende sprechen.
Rundblick: Beim Ausbau der Windenergie gibt es inzwischen schnellere Genehmigungen. Heißt das, dass das Netz jetzt zum Flaschenhals wird?
Boxberger: Leider ja. Wir haben zwar Regionen, wo sich ein Windpark innerhalb eines Jahres ans Netz bringen lässt, weil ein Umspannwerk noch Kapazitäten frei hat. Aber wenn ein neuer Großtransformator notwendig wird, reden wir von Lieferzeiten zwischen drei und sieben Jahren. Das Gleiche gilt für komplett neue Umspannwerke, die auf der grünen Wiese geplant werden müssen. Diese Vorläufe werden in politischen Debatten gern unterschätzt – doch sie entscheiden am Ende, ob der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik tatsächlich Wirkung entfalten kann.
Rundblick: Hätte man das nicht voraussehen können?
Boxberger: Nach 25 Jahren Erneuerbare-Energien-Gesetz kann man nicht mehr so tun, als sei das alles überraschend. Politik hat zu oft auf installierte Leistung geschaut, statt auf einspeisbare und nutzbare Kilowattstunden. Erfolg misst sich daran, wie viel CO2-freier Strom tatsächlich beim Verbraucher ankommt.
Rundblick: Das klingt auch nach einer Kostenfrage.
Boxberger: Genau. Die Kosten sind erheblich. Wir haben die höchsten Industriestrompreise Europas. Für viele Unternehmen zählt jeder Hundertstel Cent im internationalen Wettbewerb. Wenn wir weiter nur die Zahl der genehmigten Windräder als Maßstab nehmen, ohne zu schauen, was davon wirklich ins Netz eingespeist wird, machen wir die Energiewende teurer, als sie sein müsste.
Rundblick: Ein großes Thema ist derzeit der Boom bei Batteriespeichern. Wie beurteilen Sie das?

Boxberger: Speicher sind zweifellos ein wichtiges Element, weil sie Schwankungen bei Wind- und Sonnenstrom kurzzeitig ausgleichen können. Aber was wir derzeit erleben, ist eine regelrechte Goldgräberstimmung. Allein bei uns sind mehr als 2000 Anfragen eingegangen – das ist eine unglaubliche Zahl. Auf den ersten Blick klingt das nach einem Boom, auf den man stolz sein kann. Schaut man genauer hin, sieht man aber, dass für 90 bis 95 Prozent dieser Projekte keine uneingeschränkten Netzkapazitäten verfügbar sind. Viele Entwickler rechnen damit, dass sie jederzeit einspeisen oder Strom aufnehmen können – so, wie es ihr Business Case verlangt. In der Realität gibt es aber zeitweise Engpässe, die das verhindern. Hinzu kommen Faktoren wie die wachsende Zahl von Stunden mit negativen Strompreisen, die das Geschäftsmodell für Speicher extrem attraktiv machen. Das treibt die Anfragen in die Höhe, auch mit sehr spekulativen Projekten. Das erzeugt Erwartungen, die wir in der Praxis gar nicht erfüllen können.
Rundblick: Wenn so viele Speicher, Windparks und Industrieprojekte gleichzeitig ans Netz wollen: Haben wir nicht ein grundsätzliches Mengenproblem?
Boxberger: Ja, das haben wir. Jede einzelne Anfrage muss individuell geprüft werden – und wir reden hier nicht über zehn oder zwanzig Projekte, sondern über hunderte gleichzeitig. Das ist faktisch Manufakturarbeit. Unsere Experten müssen für jeden Standort analysieren: Welche Netzmaßnahmen sind nötig, wie viele Betriebsstunden sind realistisch, wo entstehen Engpässe? In einer Region wie Helmstedt etwa, wo die Nachfrage besonders hoch ist, haben wir alle Projektentwickler einmal an einen Tisch geholt, um gemeinsam aufzuzeigen, was möglich ist und was nicht. Denn wenn jeder nur seinen eigenen Antrag stellt, ohne zu wissen, dass noch zwanzig andere in der Warteschlange stehen, entstehen falsche Erwartungen. Genau deshalb kommt es zu Frust: Die Entwickler rechnen mit uneingeschränkten Kapazitäten, das Netz gibt das aber nicht her.
Rundblick: Wer darf denn eigentlich zuerst ans Netz, wenn mehrere gleichzeitig anklopfen?
Boxberger: Nach der geltenden Rechtslage müssen wir alle Anfragen gleichrangig berücksichtigen, egal ob Batteriespeicher, Industrieunternehmen oder Rechenzentrum. Laut dem sogenannten Windhundprinzip gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das führt zu Konflikten. Stellen Sie sich vor: Ein Betrieb, der seit Jahrzehnten vor Ort ist und investieren will, bekommt gesagt: „Tut uns leid, zuerst ist der Speicher dran.“ Das versteht niemand. Deshalb brauchen wir eine klare Priorisierung, die zum Beispiel auch Wertschöpfungsfaktoren und die Sicherung beziehungsweise Schaffung von Arbeitsplätzen mit einbezieht. Speicher sollen netzneutral sein, dürfen also keine Engpässe verschärfen.
Rundblick: Ein weiterer Knackpunkt ist die Versorgungssicherheit bei Dunkelflauten.
Boxberger: Eine siebentägige Dunkelflaute kann man mit Speichern nicht überbrücken. Wir brauchen dafür regelbare Erzeugung. Gaskraftwerke, die später auf Wasserstoff umgestellt werden können, gehören dazu – auch wenn das teuer ist. Außerdem sollten wir die Biogasanlagen im Strommarkt halten. Das ist grundlastfähige Erzeugung mit heimischen Energieträgern. Ich halte es für einen Fehler, wenn Betreiber zunehmend in die reine Gaseinspeisung wechseln sollten.
Rundblick: Aber gerade Biogas ist in Niedersachsen politisch kein Lieblingsthema.
Boxberger: Neue Anlagen brauchen wir nicht, aber die bestehenden sollten als zuverlässige Stromerzeuger erhalten bleiben. Biogas ist ein erprobter Energieträger und Teil einer dezentralen Versorgung. In einem Agrarland wie Niedersachsen kann das einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten.
Rundblick: Sie haben die hohen Strompreise erwähnt. Lassen Sie uns das noch einmal vertiefen. Wo liegen die größten Kostentreiber?
Boxberger: Zum einen beim Redispatch, also beim Eingreifen ins System, wenn Erzeugung und Netz nicht zusammenpassen. Das kostet jedes Jahr Milliarden – völlig unnötig, wenn man Erzeugung und Netze besser aufeinander abstimmen würde. Zum anderen bei der Erdverkabelung: Wir haben durch den politischen Vorrang für Kabel statt Freileitungen Infrastrukturkosten, die auf das gesamte Stromnetz bezogen 20 bis 30 Milliarden Euro höher sind, als sie sein müssten. Im Höchstspannungsbereich bedeutet jede Entscheidung gegen Freileitungen Mehrkosten, die am Ende alle Verbraucher zahlen.
Rundblick: Heißt das, die Strompreise sinken gar nicht mehr?
Boxberger: Kurzfristig nicht. Bis 2029 investieren wir knapp vier Milliarden Euro – einen Großteil davon in den Netzaus- und Umbau. Das schlägt sich auf längere Sicht in den Netzentgelten nieder, die alle Verbraucher zahlen. Prognosen, etwa von Agora Energiewende, gehen davon aus, dass der Kostengipfel zwischen jetzt und Anfang der 2030er Jahre liegt. Erst danach könnten die Systemkosten wieder sinken, wenn sich Skaleneffekte einstellen. Bis dahin müssen wir uns ehrlich darauf einstellen, dass Strom tendenziell teurer wird – nicht billiger.
Rundblick: Das klingt ernüchternd.
Boxberger: Ja, aber man darf nicht nur auf den Preis schauen. Wir bekommen dafür eine Dividende: Der CO2-Faktor pro Kilowattstunde ist in den letzten zehn Jahren um rund 25 Prozent gesunken. Jede Kilowattstunde Strom ist also klimafreundlicher geworden. Und wir gewinnen Unabhängigkeit von fossilen Importen. Das ist ein sicherheitspolitischer Wert, den man nicht unterschätzen darf.
Rundblick: Ein Teil der Stromkosten sind Netzentgelte. Droht da eine Schieflage zwischen Industrie und Privathaushalten?
Boxberger: Bisher zahlen nur Verbraucher Netzentgelte, Einspeiser aber nicht. Dabei nutzen sie das System genauso. Wenn wir bald Hunderttausende Einspeiser haben, wird das Problem größer. Ich bin dafür, dass auch neue Einspeiser künftig einen Beitrag leisten. Das ist politisch nicht beliebt, aber notwendig. Eine Infrastruktur wie das Stromnetz ist Daseinsvorsorge – die Kosten müssen auf einer breiteren Basis verteilt werden.
Rundblick: Kommen wir zum Thema Akzeptanz. Reicht die Akzeptanzabgabe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Kommunen?

Boxberger: Sie ist sinnvoll, weil sie vor Ort die Akzeptanz verbessert – die berühmte „License to operate“. Viele Projektentwickler lassen ohnehin Geld in der Region, indem sie lokale Unternehmen beteiligen oder Flächenpachten zahlen. Aber wo das nicht geschieht, kann eine Abgabe helfen, die Bevölkerung einzubinden. Trotzdem löst das allein das Problem nicht. Bürgerinnen und Bürger sehen steigende Strompreise und neue Eingriffe in ihre Landschaft, sei es durch Leitungen oder Windräder. Da reicht es nicht, wenn am Ende ein Kindergarten oder ein Radweg finanziert wird. Die Menschen fragen sich: Was habe ich selbst davon, dass dieses System umgebaut wird? Früher sprach man von einer Friedensdividende nach der Wiedervereinigung – heute brauchen wir so etwas wie eine Energiewende-Dividende. Und die besteht darin, dass wir zeigen: Unsere Kilowattstunde Strom wird jedes Jahr klimafreundlicher, wir werden unabhängiger von Energieimporten und wir sichern die Versorgung in unsicheren Zeiten. Diese Botschaft müssen wir sehr viel stärker vermitteln.
Rundblick: Niedersachsen produziert schon heute mehr Strom, als es verbraucht. Wie verhindern wir, dass das Land nur Energieexporteur bleibt?
Boxberger: Wir brauchen mehr Ansiedlungen, die von der sauberen Energie profitieren. Rechenzentren, mindestens netzneutrale Speicher, Industrieprojekte wie eine Produktion am Standort eines alten Kohlekraftwerks – das sind gute Beispiele. Aber: Die Nutzung von mehr heimischen Stroms in neuen Gewerbe- und Industrie-Ansiedlungen darf nicht durch den Abbau bestehender Industrien, etwa aufgrund zu hoher Kosten und Wettbewerbs-Nachteile zunichte gemacht werden. Das ist meine Sorge.
Rundblick: In der Debatte tauchen regelmäßig Strompreiszonen auf. Würde das Niedersachsen nutzen?
Boxberger: Das ist ein Schlagwort, das vom Wesentlichen ablenkt. Viel entscheidender ist, dass wir unsere Hausaufgaben vor Ort machen: eine kluge Netzintegration neuer Windeignungsflächen, faire Vergütungssysteme für Biogas, Transparenz im Netzausbau. Das liegt nicht in Brüssel oder Berlin, sondern in Hannover.