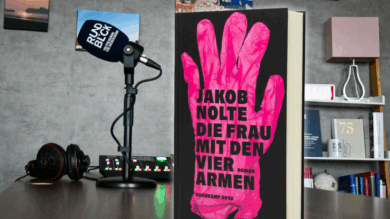Wie weit geht das Auskunftsrecht von Landtagsabgeordneten – und wo endet es, weil die schutzwürdigen Interessen Dritter berührt werden? Zu dieser Frage hat der Niedersächsische Staatsgerichtshof am Donnerstag ein wegweisendes Urteil gesprochen. Der AfD-Landtagsabgeordnete Stephan Bothe hatte eine Anfrage an die Landesregierung gerichtet und wollte wissen, wie die Vornamen der 19 Tatverdächtigen lauten, die in der Silvesternacht 2022 auf 2023 nach Polizeiermittlungen in einigen von 22 Städten ermittelt worden waren. Das Innenministerium hatte die Antworten mit Hinweis auf die Rechte der Betroffenen verweigert. Bei der relativ kleinen Zahl von Verdächtigen könne anhand der Vornamen eine Identifizierbarkeit jedes einzelnen möglich sein – und das greife zu stark ins Persönlichkeitsrecht ein. Dieser Argumentation folgte der Staatsgerichtshof nun. Die Richter bezeichneten die Klage von Bothe für zulässig, aber unbegründet. Das Interesse des Abgeordneten, die Täter nach Kenntnis von Vornamen einem „Milieu“ zuzuordnen, sei nicht überwiegend gegenüber dem Persönlichkeitsinteresse der Tatverdächtigen.
Der Kern der Debatte war in der Verhandlung Anfang März gar nicht ausführlich angesprochen worden. Bothe wollte mit einer Auskunft darüber, welche Vornamen die Tatverdächtigen haben, einen Hinweis auf den Migrationshintergrund klären. Die überwiegende Zahl der Betroffenen hat die deutsche Staatsangehörigkeit, anhand von Vornamen ließe sich aber vermutlich ablesen, dass viele von ihnen aus Familien stammen, die keine deutschen Wurzeln haben. Das Gericht urteilte nun, dass Bothes Interesse an der Klärung dieser Frage wohl berechtigt sein mag, die Antwort sei aber schon gegeben. Denn der Migrationshintergrund vieler Tatverdächtiger sei bereits in der Antwort auf eine frühere Anfrage einer CDU-Landtagsabgeordneten eingeräumt worden. Damit ziele die Anfrage des AfD-Abgeordneten auf die Klärung eines Sachverhalts, der von der Landesregierung gegenüber dem Parlament schon erklärt worden sei. In Artikel 24 der Landesregierung ist festgelegt, dass die Landesregierung Anfragen von Abgeordneten „nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig“ beantworten muss. Abweichen darf sie nur, wenn es um geheime Informationen geht, die dem Wohl des Landes schaden – oder wenn „schutzwürdige Interessen Dritter verletzt werden“. Auf diesen Passus hatte sich die Landesregierung in ihrer Antwort-Weigerung bezogen. Der Staatsgerichtshof entschied, dass in der Abwägung zwischen dem Informationsinteresse eines Abgeordneten und den Persönlichkeitsrechten der Tatverdächtigen das letztere überwiege.