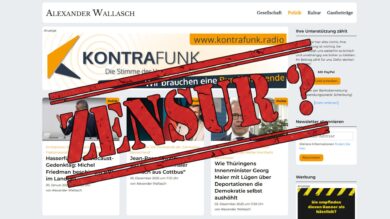Die rot-grüne Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, sich „für ein verfassungskonformes Paritätsgesetz“ einsetzen zu wollen. Damit ist eine Vorschrift gemeint, die den bisher bescheidenen Frauenanteil im Landtag, 35,6 Prozent, nach der nächsten Landtagswahl aufwerten soll – auf etwa die Hälfte der Mandate, da dies der Hälfte der Geschlechterverteilung in der Bevölkerung entspricht.

Noch wartet der Landtag auf eine Gesetzesinitiative der Regierung. Um diese Zeit zu verkürzen, legt die Rundblick-Redaktion nun schon mal einen eigenen Vorschlag vor in der Hoffnung, damit die Diskussion innerhalb der Landtagsgremien anzufachen.
So sieht unser Vorschlag aus:
Die Wahlkreise werden neu geschnitten
Gegenwärtig gibt es 87 Landtagswahlkreise mit einer Durchschnittsgröße von 69.871 Wahlberechtigten je Wahlkreis. Diese werden zusammengelegt nach dem Prinzip, dass möglichst zwei benachbarte Wahlkreise zu einem vereinigt werden. In den Randbereichen gibt es einige Arrondierungen. Wir schlagen 42 Wahlkreise mit einer Durchschnittsgröße von 144.734 Wahlberechtigten vor. Es gilt weiter die Vorgabe, dass die Ist-Zahl der Wahlberechtigten um maximal 25 Prozent nach oben oder unten vom Durchschnittswert abweichen darf. Diese Regel ist gesetzlich verbindlich überall als tolerable Schwankung akzeptiert.
Je Wahlkreis werden zwei Abgeordnete direkt gewählt
Anders als bisher gibt es je Wahlkreis nicht mehr nur ein Direktmandat, sondern zwei – eine Frau und einen Mann (oder auf dem Männerplatz eine Person mit diversen Geschlechtsmerkmalen). Der Wähler hat am Wahltag also drei Stimmen – eine für die weibliche Direktkandidatin, eine für den männlichen – oder diversen – Direktkandidaten und eine dritte Stimme für die Landesliste. Für die Sitzverteilung im Landtag ist wie bisher das Zweitstimmenresultat entscheidend. Ergeben sich wegen der Wahlkreisergebnisse Überhang- oder Ausgleichsmandate, so führen diese zur Vergrößerung des Landtags. Das ist aber hinnehmbar und gut vertretbar, da es sich beim Parlament um die Volksvertretung handelt, die als Kontrollorgan einer stetig wachsenden Exekutive gegenübergestellt ist. Die Nachrücker kommen bei Mandatsverlust eines Abgeordneten wie bisher über die Landesliste in den Landtag.

Parteien sind frei in ihrer Nominierung
Keine Partei wird gezwungen, in jedem Wahlkreis einen Mann und eine Frau aufstellen zu müssen. Sie vergibt sich aber Chancen, wenn sie darauf verzichtet. Unter den Bewerbern für das weibliche Direktmandat wird diejenige ausgewählt, die die meisten Stimmen erhält – und beim Platz für Männer – oder diverse – ist es ähnlich.
Die vergrößerten Wahlkreise werden wieder aufgeteilt
Die flächenmäßige Verdoppelung der Wahlkreisfläche birgt die Gefahr, dass am Ende zwei Direktmandate an Politiker fallen, die in einem Teil des Wahlkreises leben – während aus dem anderen Teil niemand im Parlament vertreten ist. Außerdem müssten sich zwei gewählte Wahlkreisabgeordnete immer auf eine Linie verständigen. Dieser Mangel lässt sich mindern, indem die Wahlkreise nach der Wahl für eine Aufgabenverteilung für eine logische Sekunde in zwei Hälften geteilt werden, damit zwei nach Einwohnern und Fläche etwa gleichgroße Teilmengen entstehen.
Idealerweise geschieht das mit der Orientierungshilfe der alten, auf 87 Einheiten basierenden Wahlkreisgrenzen. Im nächsten Schritt verständigen sich die beiden siegreichen Direktkandidaten, wer für welchen Teil zuständig sein soll. Kommt keine Vereinbarung zustande, entscheidet das Los. Am Ende hat jeder Wahlkreisabgeordnete eine primäre Zuständigkeit für jeweils die Hälfte seines Wahlkreises. Damit ist auch gesichert, dass das Betreuungsgebiet der Wahlkreisabgeordneten nicht zu groß wird. Bei den Zuständigkeiten liegt also die Fiktion zugrunde, es gäbe 84 Wahlkreise.

Urheberschaft für das Modell
Einige Grundzüge dieses Tandem-Modells gehen auf den verstorbenen früheren Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann aus Göttingen zurück. Er hatte einen solchen Vorschlag für den Bundestag ins Gespräch gebracht. 2019 formte daraus der Vorstand des SPD-Unterbezirks Göttingen einen Antrag für den SPD-Bezirksparteitag. Später befasste sich damit eine SPD-Arbeitsgruppe der Landespartei und formulierte ein Konzept auf der Basis von 50 Wahlkreisen – das wohl deshalb, weil eine Verdoppelung der Wahlkreisgröße für die Abgeordneten ein zu großes Betreuungsgebiet schaffen würde.
Bei 50 Wahlkreisen hieße das aber, dass 100 Direktmandate vergeben werden – mit der Konsequenz, dass die Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate erheblich größer als heute werden könnte. Das ist bei 42 Wahlkreisen und 84 Direktmandaten anders. Die Weiterentwicklung des Oppermann-Modells besteht nun darin, dass das Wahlkreis-Tandem nach der Wahl das vergrößerte Wahlkreisgebiet unter sich aufteilen muss. Damit wird die Gefahr von Konkurrenzen und Doppel-Zuständigkeiten minimiert. Gleichzeitig kann das Tandem nach außen den Wahlkreis auch gemeinsam repräsentieren.
Fehlende Kandidaturen
Da es keine Verpflichtung für die Parteien gibt, in jedem Wahlkreis einen Mann und eine Frau aufzustellen, sind Ausnahmeregeln nötig. Findet sich kein männlicher (oder diverser) Bewerber für den für ihn reservierten Platz, kann dort auch eine Frau kandidieren. Dann könnte es sein, dass beide Direktmandate eines Wahlkreises nach der Wahl weiblich sind. Findet sich keine Bewerberin für den Frauenplatz, so müsste dieser unbesetzt bleiben. Die Parteien hätten dann, weil sie keine Frau aufgestellt haben, dem Wahlkreis geschadet – da anstelle von zwei möglichen nur ein Direktmandat zugeteilt werden kann.

Das erhöht den Druck auf die Parteien, Frauen aufzustellen. Außerdem sollte die Möglichkeit der Nein-Stimme bei den Direktkandidaten eingeführt werden. Wenn keiner der männlichen und keine der weiblichen Kandidaten bei ausreichend Wählern Zuspruch findet und die Nein-Stimmen in beiden Fällen überwiegen, würden die entsprechenden Direktmandate nicht zugeteilt werden. Ein Wahlkreis könnte so schlimmstenfalls ohne Wahlkreisabgeordneten im Parlament bleiben. Der Vorteil ist aber, dass der Wähler die Chance hätte, seine Unzufriedenheit mit den Direktkandidaten zu dokumentieren.
Die Listen-Parität wird angestrebt
Neben der Einführung solcher Wahlkreis-Tandems sollte geprüft werden, inwieweit den Parteien gesetzlich ein Reißverschlussverfahren für die Landeslisten-Aufstellung vorgeschrieben werden kann. Das hieße, dass abwechselnd ein Mann und eine Frau auf der Liste kandidieren müssen – auf den Männerplätzen wären auch diverse Geschlechter denkbar. In einigen Bundesländern hat es gegen Gesetze, die in diese Richtung gehen, massive rechtliche Bedenken gegeben. Gut möglich wäre es also, dass das Ziel paritätischer Landeslisten lediglich als Aufforderung, also als ein Appell an die Parteien, verankert wird. Mindestens dieser Schritt ist aber geboten, da aus dem Grundgesetz ein Auftrag zur besseren Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten abgeleitet werden kann.