In mehr als einhundert Fällen laufen derzeit EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das klingt zunächst nach viel, ist aber halb so wild. Denn in den meisten Fällen geht es nicht um große Verstöße, sondern lediglich um Verzug bei der Umsetzung von EU-Richtlinien – oder um unterschiedliche Auffassungen darüber, wie genau etwas umgesetzt werden sollte, was aus Brüssel vorgegeben wurde. Noch kein einziges Mal seit 1952 ist Deutschland vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) verurteilt worden und musste tatsächlich Strafe zahlen.

Doch das könnte sich ändern. Zum einen, weil zwei Verfahren allmählich pressieren. Zum anderen, weil es seit kurzem neue Verfahren gibt, die deutlich schneller zu Sanktionen führen könnten als bisher. In manchen Fällen ist Niedersachsen ganz direkt davon betroffen, weil das Land bei der Umsetzung trödelt. In anderen Fällen muss das Land reagieren, sobald der Bund gehandelt hat. Doch auch in diesen Fällen käme womöglich eine Strafzahlung auf Niedersachsen zu.
Bereits seit 2015 läuft ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen der unzureichenden Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU. Niedersachsen war dabei eines der Sorgenkinder, denn die Ausweisung der Schutzgebiete zog sich hier noch über Jahre hin. Im vergangenen Frühjahr hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) daraufhin Druck gemacht. Er gab die Zielmarke aus, dass bis zur Sommerpause alle kommunalen Vertretungen ihre Schutzgebiete EU-konform ausweisen und sichern sollten. Eine noch weitere Verzögerung durch die Kommunalwahlen sollte damit verhindert werden. Lies gab damit den Druck aus Brüssel an die Kommunen weiter, denn im Februar 2021 hatte die EU-Kommission erklärt, vor dem EuGH Klage gegen die Bundesrepublik zu erheben.

Für Niedersachsen hätte ein Sanktionsurteil teuer werden können, denn die Strafgeldforderung könnte der Bund an jene Länder weitergeben, die für das Urteil verantwortlich sind. Jene Bundesländer, die die EU-Vorgaben noch nicht erfüllt hätten, wären also zur Kasse gebeten worden – und hätten sich die Strafgelder gemäß dem Königsteiner Schlüssel teilen müssen. Ende Februar kam nun noch einmal Unruhe in das Verfahren, als die EU-Kommission ihre Klageschrift vorgelegt hatte. Bemängelt wurden die fehlende Ausweisung von 88 Gebieten sowie ein Verstoß gegen eindeutig messbare Schutzziele. Doch Umweltminister Lies betrachtet das Agieren Brüssels gelassen. Er ist von der Rechtmäßigkeit des niedersächsischen Vorgehens überzeugt, sieht das Land auf einem guten Weg, die Klageschrift sei inzwischen überholt und er würde es auf eine richterliche Überprüfung ankommen lassen. Träfe der EuGH nun bald ein Feststellungsurteil, bliebe der Bundesrepublik immer noch Zeit, um nachzubessern, bevor dann Jahre später ein Sanktionsurteil anstünde.
Weiter vorangeschritten ist unterdessen das Vertragsverletzungsverfahren zur Nitrat-Richtlinie. Diese Brüsseler Vorgabe zielt auf den Schutz von Grundwasser und Fließgewässern vor einem zu hohen Nährstoffeintrag etwa aus der Landwirtschaft. Seit Jahren läuft dieses Verfahren, 2018 hat der EuGH das Feststellungsurteil erlassen, in dem festgehalten wurde, dass die Düngeverordnung nicht ausreiche. Ein Ausfluss dieser Vorgabe sind die hoch umstrittenen „roten Gebiete“, die von den Ländern ausgewiesen werden müssen. In jenen Regionen, in denen die Nitratbelastung im Grundwasser einen gewissen Grenzwert überschreiten, verlangt die EU nun konkrete Schutzmaßnahmen. Inzwischen wurde auch Klage erhoben mit einem Sanktionsantrag.

Sollte Brüssel mit den von den Ländern vorgeschlagenen Maßnahmen nicht einverstanden sein, und der EuGH verhinge daraufhin ein Sanktionsurteil, würde es teuer für die Bundesrepublik. Zu zahlen wäre zum einen ein Pauschalbetrag, der sich aus einem fixen Grundbetrag, einem Schwerekoeffizienten, einem Länderfaktor (bei Deutschland liegt dieser bei 5) und der Anzahl der Tage zwischen dem Feststellungsurteil und dem Sanktionsurteil ergibt. Im mildesten Fall müsste Deutschland nach aktuell gültiger Berechnungstabelle 4545 Euro, im schlimmsten Fall sogar 90.900 Euro für jeden zwischen den beiden Urteilen verstrichenen Tag zahlen. Hinzu käme ein tägliches Zwangsgeld, das zu entrichten ist, bis der EU-Vorgabe folgegeleistet wurde. Auch dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen und changiert zwischen einem Tagessatz von 13.630 Euro und 817.800 Euro.
Seit 2019 kennt die EU ein neues, einstufiges Vertragsverletzungsverfahren. Bei diesem Verfahren kann ein Feststellungs- und Sanktionsurteil bereits knapp zwei Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist folgen. Zum Vergleich: Beim zweistufigen Vertragsverletzungsverfahren lagen zwischen dem Ablauf der Umsetzungsfrist und dem Sanktionsurteil locker sieben Jahre – und damit viel Zeit, um nachzubessern und einer Strafzahlung zu entgehen. Ein erster Fall, der sowohl die Bundesrepublik insgesamt als auch nachgelagert Niedersachsen betrifft, ist die sogenannte Wistleblower-Richtlinie. Diese EU-Regelung zum Schutz von Beschäftigten, die Rechtsverstöße in ihren Unternehmen oder Behörden melden, hätte bis 2021 in nationales Recht überführt werden müssen. Doch weil sich SPD und CDU/CSU in der Großen Koalition nicht einig wurden, klafft hier eine Lücke.

Die damalige Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hätte die Inhalte der EU-Richtlinie gerne auf sämtliche Ebenen. Der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bestand allerdings auf der im Koalitionsvertrag vereinbarten Minimal-Umsetzung, die den Schutz nur für jene Hinweisgeber gewährleisten sollte, die Verstöße gegen EU-Recht anprangerten. Am 17. Dezember ist die Umsetzungsfrist verstrichen, Ende Januar informierte die EU-Kommission die Bundesregierung über das Versäumnis, Anfang Februar machte die Brüsseler Behörde den Vorgang offiziell. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat nun Anfang April seinen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung gegeben.
Sobald der Bund gehandelt hat, muss das Land entsprechend nachziehen. Geschieht dies rasch genug, kommen alle noch mit einem blauen Auge davon. Käme es jedoch zu einem Sanktionsurteil, bevor der Bundestag entschieden hat, träfe die pauschale Strafzahlung Bund und Länder gleichermaßen – allerdings das tägliche Strafgeld zunächst nur den Bund. Die neuen Verfahren sind übrigens nicht nur schneller, sondern im Zweifel auch teurer. Denn das pauschale Strafgeld berechnet sich bei diesen Verfahren anhand der Tage zwischen dem Ablauf der Umsetzungsfrist und dem Sanktionsurteil und nicht wie beim zweistufigen Verfahren nur anhand der Tage zwischen dem ersten und dem zweiten Urteil. Teuer wird es rückwirkend also ab dem ersten Tag.
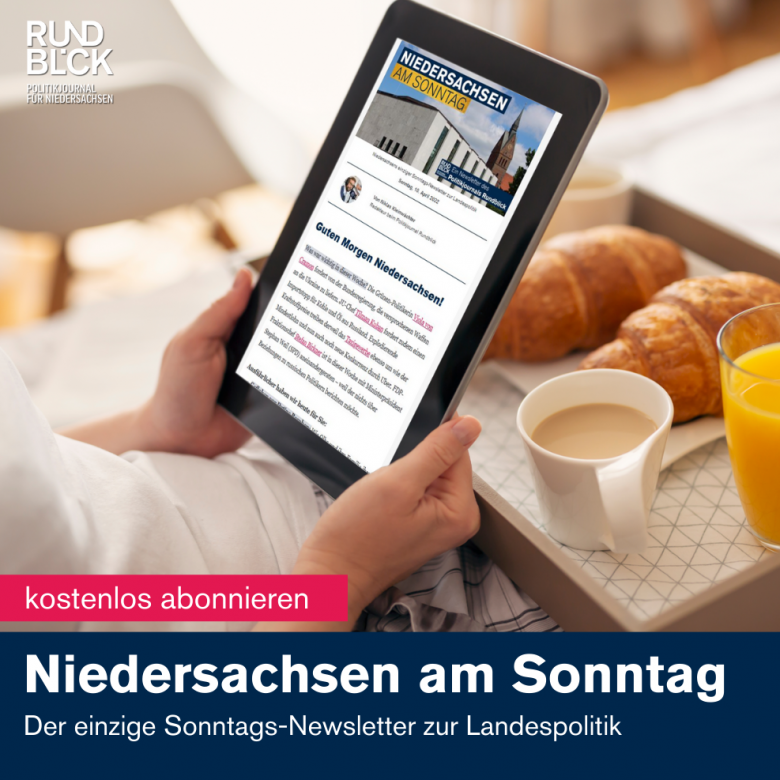
Die Umsetzung der allermeisten EU-Richtlinien vollzieht sich heimlich und weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Erst wenn es zur Eskalation kommt, richten sich die Scheinwerfer auf diese Themen. Damit es im Idealfall aber gar nicht dazu kommt, behalten auch auf Landesebene die Experten des Europaministeriums die Richtlinien im Blick und schauen genau auf die laufenden Vertragsverletzungsverfahren. Es wird analysiert, welche davon Niedersachsen ganz besonders betreffen könnten. Durch das neue, einstufige Vertragsverletzungsverfahren sind die Juristen des Europaministeriums in besonderer Alarmbereitschaft. Ein Jahr vor Ablauf einer jeden Umsetzungsfrist fordern sie nun vom zuständigen Fachministerium einen Umsetzungsplan. Drängt die Zeit, wird die Priorität hochgesetzt und etwa in Zusammenarbeit mit dem Ältestenrat und dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst geschaut, wie man ein Verfahren beschleunigen kann – beispielsweise über die Landes-Gesetzgebung. Besonders vor Wahlen wird das allerdings heikel, weil sich hier die Prioritäten rasch verschieben. Da muss die Verwaltung dann ganz genau hinschauen.


