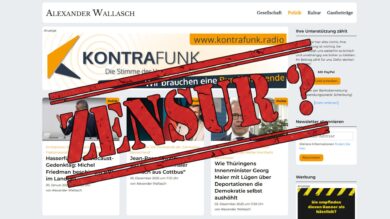Bremen trifft es mit voller Wucht, aber auch Niedersachsen spürt die Auswirkungen: Mit dem Rückzug von Arcelor-Mittal aus seinen Plänen zur klimaneutralen Stahlproduktion bricht nicht nur ein milliardenschweres Leuchtturmprojekt der deutschen Industriepolitik weg. Die Entscheidung reißt auch Lücken in ein regionales Netzwerk, das für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft im Nordwesten als Musterbeispiel galt. Nun zeigt sich: Schöne Pläne allein reichen nicht – wenn die Marktbedingungen nicht stimmen, macht selbst ein Weltkonzern einen Rückzieher.

Arcelor-Mittal gilt mit mehr als 158.000 Beschäftigten in mehr als 60 Ländern als größter Stahlhersteller der Welt – ein Schwergewicht, das allein 2023 gut 68 Milliarden US-Dollar Umsatz machte. Rund 8000 Mitarbeiter arbeiten hierzulande für den Konzern, die größten Standorte sind Bremen und Eisenhüttenstadt. Genau dort wollte Arcelor-Mittal mit Milliardenaufwand vorangehen: Die Flachstahlwerke sollten schrittweise dekarbonisiert, klimaschädliche Hochöfen durch moderne Direktreduktionsanlagen und neue Elektrolichtbogenöfen ersetzt werden. Für dieses Vorhaben standen rund 1,9 Milliarden Euro auf dem Papier, davon war der Großteil – gut 1,3 Milliarden Euro – an staatlicher Unterstützung eingeplant.
Doch nach eingehender Prüfung kam der Stahlriese zu einem klaren Ergebnis: „Selbst mit der finanziellen Unterstützung ist die Wirtschaftlichkeit dieser Umstellung nicht ausreichend gegeben, was das Ausmaß der Herausforderung verdeutlicht“, sagt Geert Van Poelvoorde, CEO von Arcelor-Mittal Europe. Hohe Stromkosten, unsichere Wasserstoffverfügbarkeit und eine schwankende Nachfrage machen die Rechnung nicht tragfähig. Deshalb sollen die Investitionen dorthin fließen, wo die Rahmenbedingungen verlässlicher sind. Arcelor-Mittal wird dabei ungewöhnlich deutlich: „Die ersten neuen Elektrolichtbogenöfen werden in Ländern gebaut, die eine wettbewerbsfähige und planbare Stromversorgung bieten können.“ Tatsächlich zahlt die energieintensive Industrie in Deutschland europaweit mit die höchsten Strompreise: Branchenangaben zufolge liegen sie bei 13 bis 16 Cent pro Kilowattstunde, während Frankreich dank staatlich subventioniertem Atomstrom und langfristiger Verträge oft nur 5 bis 7 Cent aufruft. Der Rückzug ist damit kein taktisches Manöver, sondern ein klares Signal an alle, die auf die grüne Stahlwende setzen.

Wie eng Stahl und Wasserstoff im Nordwesten zusammenspielen, zeigt sich direkt bei EWE. Der Oldenburger Energiekonzern hat seine Pläne für eine 50-Megawatt-Elektrolyse in Bremen bereits gestoppt, weil ein zentraler Abnehmer fehlt. Die Anlage sollte vor Ort grünen Wasserstoff erzeugen, um das Bremer Stahlwerk zu versorgen und zugleich den Startschuss für eine lokale Wasserstoffwirtschaft geben. Mit der Absage fehlt dieser Anker – auch die größere 320-Megawatt-Anlage in Emden gerät unter Druck. EWE-Chef Stefan Dohler sagte dazu im Weser-Kurier: „Die Transformation der Industrie gelingt nur, wenn Wasserstoff nicht nur politisch gewollt, sondern auch wirtschaftlich machbar ist.“ Ohne klare Abnahmeverträge, wettbewerbsfähige Strompreise und verlässliche Förderung drohe der ganze Verbund ins Wanken zu geraten. „Deutschland und Europa müssen liefern: bei Strompreisen, bei Förderung, bei Infrastruktur“, mahnt Dohler.
Mit Sorge blickt nun auch die Salzgitter AG auf die Entwicklung. Der Konzern gilt mit seinem Milliardenprojekt "Salcos" bundesweit als Vorreiter bei CO2-armem Stahl. Noch ist der Umbau alles andere als abgeschlossen: Seit Anfang 2024 wird auf Niedersachsens größter Industriebaustelle an Direktreduktionsanlagen, Elektrolichtbogenöfen und einer eigenen Wasserstoffproduktion gearbeitet. Allein die erste Stufe kostet rund 2,3 Milliarden Euro, weitere Ausbauschritte bis 2033 sollen die Emissionen fast auf null senken. Bisher flossen rund eine Milliarde Euro an öffentlichen Fördermitteln, doch steigende Bau- und Materialkosten treiben den Finanzbedarf weiter in die Höhe. Bund und Land verhandeln deshalb über eine neue Förderung in dreistelliger Millionenhöhe. Doch der Fall Bremen zeigt, wie schnell selbst gut gemeinte Zusagen ins Wanken geraten können, wenn Markt und Energiepreise nicht mitspielen.
Dass es nicht nur um staatliche Förderzusagen geht, zeigt ein Blick auf den Markt. Viele Kunden betonen inzwischen, dass sie CO2-arme Lieferketten wollen – doch am Verhandlungstisch entscheidet oft noch immer der Preis. Alexander Becker, CEO der Georgsmarienhütte-Gruppe und Vizepräsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, bringt es auf den Punkt: „Wir können keine Anlagen bauen, die dann stillstehen“, sagte er kürzlich bei einer CDU-Veranstaltung in Oyten (Landkreis Verden). Becker erwartet von der Bundesregierung, dass sie ihr Versprechen einhält und den Industriestrompreis um mindestens fünf Cent senkt. Die Industrie brauche dringend ein klares Zeichen aus Berlin, dass es wieder aufwärts geht. „Dann werden wir auch wieder in Deutschland investieren. Wir haben alle Lust, aus diesem Jammermodus rauszukommen und wieder Gas zu geben“, so Becker. Frankreich hat für große Industriebetriebe bereits einen gedeckelten Strompreis – Deutschland ringt dagegen noch immer um eine eigene Lösung. Für IG-Metall-Vize Jürgen Kerner ist das ein Problem: „Es ist inakzeptabel, dass Frankreich Fakten schafft, während Deutschland umständlich verhandelt. Stahl muss auch bei uns zur Chefsache werden.“

Arcelor-Mittal selbst wird noch deutlicher. Das Unternehmen warnt, dass hohe Importe die europäische Produktion unter Druck setzen. „Die höchste Priorität ist derzeit, die Stahlnachfrage in Europa so wiederzubeleben, dass europäische Hersteller auch daran teilhaben können. Die hohen Importe sind ein großes Problem – wir brauchen eine Begrenzung der Importe für Flachprodukte auf 15 Prozent, was einer Reduzierung um etwa 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand entspricht", sagte Europa-CEO Van Poelvoorde. "Wenn das erreicht ist, wird die Branche auch in einer viel besseren Position sein, um Investitionen in die Dekarbonisierung voranzutreiben.“ Dass dabei nicht nur Pipelines und Offshore-Windparks zählen, sondern vor allem die Abnahme, macht auch EWE-Chef Stefan Dohler deutlich. Ohne verlässliche Nachfrage bleibe die schönste Infrastruktur nur eine leere Hülle.
Die Unternehmensberatung Oliver Wyman hat zusammen mit IW Consult im Auftrag der Wirtschaftsvereinigung Stahl untersucht, welche Risiken die Transformation ausbremsen können. Laut Studie hängt rund ein Viertel der industriellen Wertschöpfung in Deutschland direkt oder indirekt an der Stahlproduktion – mit ihr stehen oder fallen ganze Produktionsnetzwerke. Trotzdem halten nur 14 Prozent der befragten Kundenunternehmen es für wahrscheinlich, dass die grüne Transformation unter den aktuellen Bedingungen gelingt. Das größte Risiko sehen sie in zu hohen Energiepreisen, fehlender Planbarkeit und der unsicheren Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff. Die Berater warnen: Ohne wettbewerbsfähige Strompreise, eine verlässliche Wasserstoffinfrastruktur und Abnehmer, die auch höhere Preise akzeptieren, droht ein "Schneeballeffekt": Teile der Wertschöpfung könnten ins Ausland abwandern. Bremen gilt vielen als Beleg dafür, wie schnell selbst ein Milliardenprojekt ins Kippen geraten kann, wenn Markt, Förderung und Energiepreise nicht zusammenpassen. Für Salzgitter ist das mehr als ein mahnender Blick: Hier wird sich zeigen, ob Deutschland grünen Stahl nicht nur plant, sondern auch dauerhaft bezahlen und am Standort halten will.