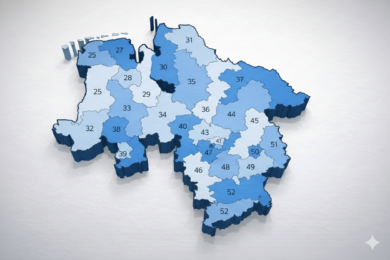Sollte am Ende der Grundschule strenger kontrolliert werden, wer aufs Gymnasium kommen darf? Mit einem Leistungstest in der vierten Klasse sammelt die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg derzeit neue Erfahrungen. Statt des Elternwillens sollen künftig die Ergebnisse des „Kompass 4“ genannten Prüfungsmodells und das Urteil der Lehrkraft über den weiteren Bildungsweg entscheiden. Im vergangenen November fanden die ersten entsprechenden Prüfungen in Deutsch und Mathematik statt. Doch offenbar scheiterten im ersten Durchgang nicht nur zahlreiche Kinder, sondern auch gleich der Leistungstest an sich. Die Aufgaben seien zu schwer gewesen, die Zeit habe nicht ausgereicht, klagten Fachverbände im Ländle und forderten, die verbindliche Grundschulempfehlung vorerst auszusetzen. Von Chaos, Überlastung und Vertrauensverlust bei Schülern, Eltern sowie Lehrern und Rektoren wird berichtet und der Test als „Mini-Abitur“ abgestraft.

Wie zur Verteidigung des diesjährigen Vorgehens hat das baden-württembergische Kultusministerium Ende Februar die Ergebnisse einer vorläufigen Stichprobe der diesjährigen Schullaufbahnempfehlungen der Klassenkonferenzen veröffentlicht. Dieser nicht-amtlichen Erhebung zufolge wurden in diesem Jahr 51 Prozent der Schüler dem Niveau E zugeordnet, also eine Schullaufbahn mit dem Abitur als Ziel. 24 Prozent der Viertklässler habe man empfohlen, einen Realschulabschluss anzustreben. Eine Schulform, an deren Ende der Hauptschulabschluss steht, empfahl man 25 Prozent der Prüflinge. Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) versuchte das neue Verfahren zu retten, indem sie offiziell erklärte: „Das stärkste Pferd im Stall der Grundschulempfehlung ist die Rückmeldung der Lehrkräfte. Sie können die Kinder im schulischen Kontext am besten einschätzen. Deren Gymnasialempfehlungen liegen wie in den vergangenen Jahren auch diesmal um die 50 Prozent.“
Kann Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) von ihrer Amtskollegin und Parteifreundin lernen? Zunächst zum Stand der Dinge: An Niedersachsens Grundschulen entscheidet kein Test über das schulische Weiterkommen nach der vierten Klasse. Den Eltern werden allerdings zwei Beratungsgespräche angeboten. Auf Wunsch erhalten sie anschließend eine Schullaufbahnempfehlung für ihr Kind, die aber nicht verpflichtend ist. An diesem Vorgehen soll nicht gerüttelt werden, erklärte das niedersächsische Kultusministerium auf Rundblick-Anfrage. Es wird aber grundsätzlich empfohlen, sich bei der Wahl der weiterführenden Schule am Wohl der Schüler zu orientieren. Es müssten bei der Entscheidung die Fähigkeiten, Interessen, Eigenschaften, das Arbeits- und Sozialverhalten, insbesondere die schulische Lernentwicklung und nicht zuletzt die Persönlichkeit berücksichtigt werden. Denn ohne Erfolgserlebnisse gehe auch die Lernfreude und Lernmotivation verloren. Das Kultusministerium verweist auf die Durchlässigkeit des niedersächsischen Schulsystems: Mit Ausnahme der Förderschule im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung können an jeder weiterführenden Schulform im Sekundarbereich I alle Abschlüsse einschließlich des Erweiterten Realschulabschlusses erworben werden, also die Berechtigung zum Wechsel in die gymnasiale Oberstufe. Gleichzeitig geht der Weg allerdings auch in die andere Richtung: Wer am Gymnasium zweimal in Folge nicht versetzt wird, kann auf Beschluss der Klassenkonferenz auch an die Real- oder Hauptschule überwiesen werden.
Auch beim niedersächsischen Philologenverband sieht man derzeit keine Notwendigkeit, die bisherigen Grundschulempfehlungen durch weitere Leistungstest oder Auswahlverfahren zu ergänzen. „Wir setzen uns aber dafür ein, dass zumindest der Sprung über zwei Schulformen nicht mehr möglich ist“, erklärte der Verbandsvorsitzende Christoph Rabbow auf Rundblick-Anfrage. „Für uns stehen die Kinder im Mittelpunkt: Sie können nur dann positive Schul- und Lernerfahrungen machen, wenn sie auch passend gefordert und gefördert werden.“ Wer eine Hauptschulempfehlung hat, der solle nicht direkt am Gymnasium starten. Das führe bloß zu einer ständigen Überforderung der Schüler und erzeuge Frust. „Das erleben wir täglich an unseren Schulen“, berichtet der Gymnasiallehrer aus Stade. Der Philologenverband setzt sich stattdessen für einen nachgelagerten Überprüfungsprozess ein. Nach der sechsten Klasse solle evaluiert werden, ob Schüler gut an ihrer Schulform zurechtkommen oder ein Wechsel angebracht wäre, um dauerhaft negative Lernerfahrungen zu vermeiden. In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädiert man gar dafür, die Grundschulzeit auszudehnen und die Schüler erst nach der sechsten Klasse auf die weiterführenden Schulen aufzuteilen. „Wir sind der Meinung, dass in unserem Schulsystem die Kinder viel zu früh einem unverhältnismäßig hohen Leistungsdruck ausgesetzt werden. Ein Auswahlsystem mit einem Leistungstest in der vierten Klasse lehnen wir ab“, sagt der GEW-Landesvorsitzende Stefan Störmer auf Rundblick-Nachfrage. Er meint, es müsse ein Konsens mit den Eltern darüber erreicht werden, welche die beste Schulform für das Kind ist und wo es sich am besten weiterentwickeln kann.