Das hatte damals keiner kommen sehen: Im Mai 2002 brachte die CDU-Fraktion unter Christian Wulff noch einen Entschließungsantrag in den Landtag ein – mit dem Ziel, gewaltverherrlichende Computerspiele aus Niedersachsen zu verbannen. Heute, 23 Jahre später, dreht sich die Debatte darum, ob die Polizei Hannover sich künftig auch beim Zocken von Ballerspielen streamen darf.
Zur Erklärung: Es geht um die Plattform „Twitch“, auf der sich Menschen vor allem dabei filmen, wie sie Videospiele spielen – ein Konzept, das Ü-50-Jährigen wahrscheinlich nicht mehr zu vermitteln ist. Die Polizeidirektion Hannover ist dort seit Kurzem aktiv: Drei Beamte suchen als „Social-Media-Cops“ den Kontakt zur Jugend. „Für das Nebenamt sind etwa fünf Wochenstunden pro Person vorgesehen, die restliche Dienstzeit versehen die Kolleginnen und Kollegen in ihren originären Organisationseinheiten“, erklärt das Innenministerium auf Anfrage von Stephan Bothe (AfD).
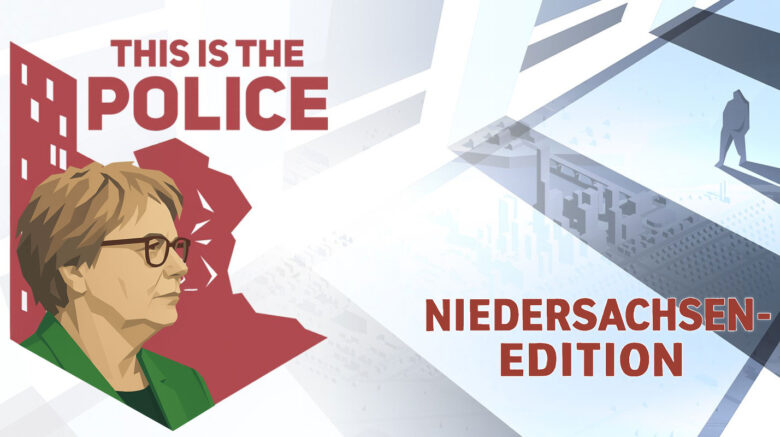
Der Twitch-Kanal dient vor allem der Prävention: Es geht um Themen wie Cybergrooming, Sextortion oder Extremismus. Nachwuchsgewinnung für die Polizei kommt aber auch nicht zu kurz. Die Botschaft: Der Rechtsstaat streamt mit. Und was man früher „aufsuchende Sozialarbeit“ nannte, heißt heute: „PolizeiHannover ist live“.
Doch es gibt Irritationen. Bothe fragte kritisch nach, ob die Polizei etwa Killerspiele wie „Grand Theft Auto“ oder „Call of Duty“ spielen wolle. Das Innenministerium beruhigt: Gewalttitel seien ausgeschlossen; ebenso Spiele, in denen gesetzeswidriges Verhalten belohnt wird. Allerdings habe die Polizeidirektion Hannover angeregt, künftig alle Spiele mit der Altersfreigabe „ab zwölf Jahren“ zuzulassen, um über populäre Titel wie „Fortnite“ mehr Reichweite zu erzielen.
„Fortnite“ – das muss man wissen – ist so etwas wie die kinderfreundliche Version eines Ego-Shooters: viel Farbe, kein Blut und schräge Tänze, die gelegentlich zur Verhöhnung gefallener Gegner eingesetzt werden. Was „Teabagging“ bedeutet und was das mit „Fortnite“ zu tun hat, lasse ich an dieser Stelle lieber aus.
Im Innenministerium zeigt man Verständnis für den Vorstoß der Social-Media-Beamten. Auch problematische Spiele könnten im Rahmen der Prävention eine Rolle spielen – etwa dann, wenn es darum gehe, sie kritisch einzuordnen und mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen. Warum das aus Sicht des Ministeriums nicht so einfach ist: „Es ist nicht das Ziel polizeilicher Social-Media-Aktivitäten, gewaltverherrlichende oder jugendgefährdende Inhalte zu fördern oder zu normalisieren." Fazit: Es bleibt bis auf Weiteres beim „Fortnite“-Verbot.

Statt „Fortnite“ bleibt also vorerst nur die pädagogisch unbedenkliche Auswahl: „Mario Kart World“, „Paddle, Paddle, Paddle“ oder „Police Simulator“. Die Mega-Reichweite bringt das vermutlich nicht – aber irgendwo muss man ja anfangen. Notfalls eben mit Blaulicht, Booten und Bananenschalen.
Um Sicherheit, die Polizei und Technologie geht es auch heute im Rundblick. Das sind unsere Themen:
Kommen Sie gut durch den digitalen Raum. Und vergessen Sie nicht: Auch im Chat gilt das Grundgesetz.
Ihr Christian Wilhelm Link


