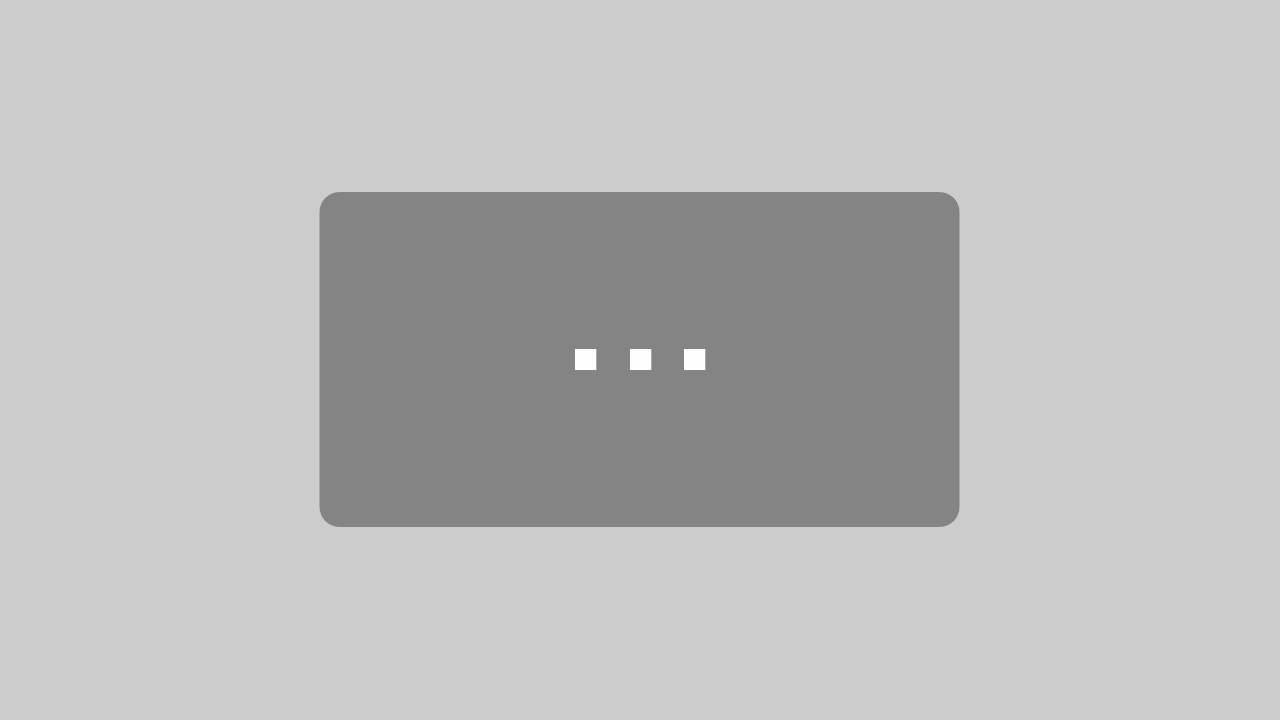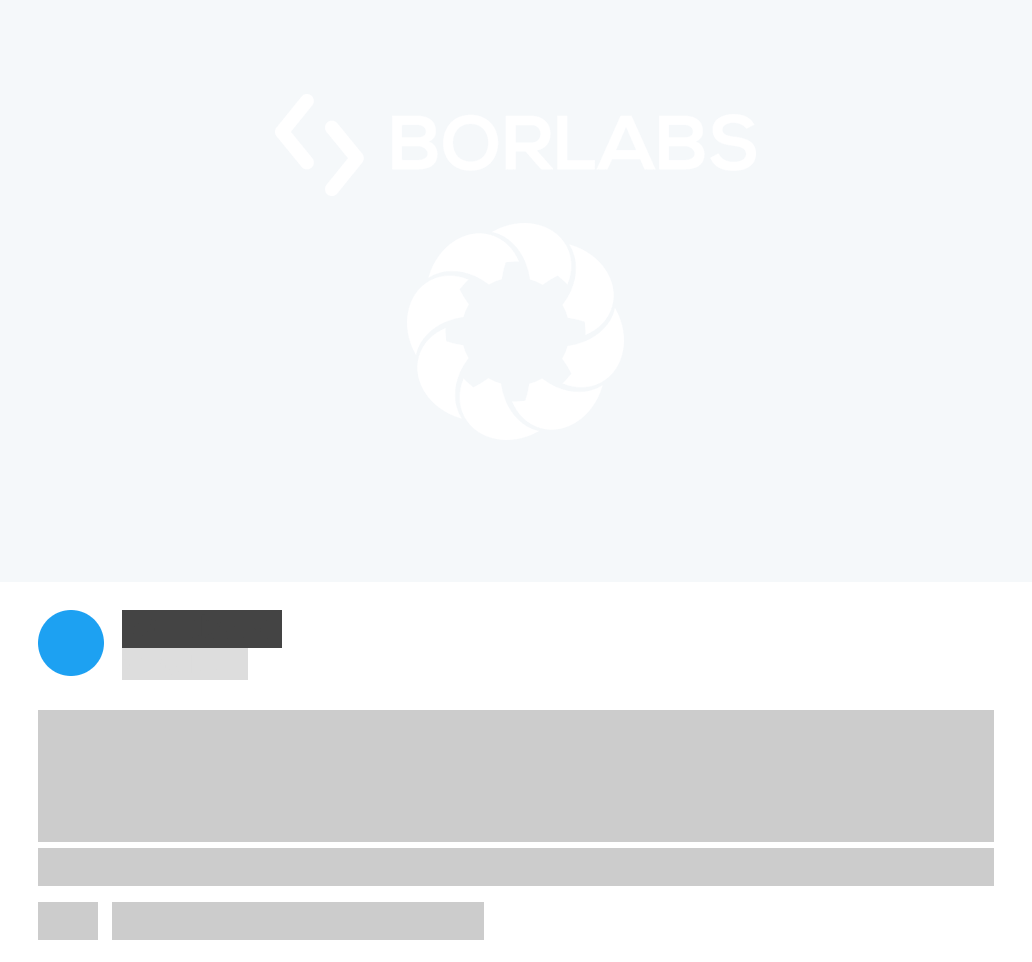Der Bund plant, das Krisenmanagement an sich zu ziehen
Die Corona-Krise ist noch längst nicht vorüber, der schlimmste Teil kommt vermutlich erst noch. Nun gedeiht im Bundesgesundheitsministerium ein Plan, der gestern auch in der Telefonkonferenz von Kanzlerin und Ministerpräsidenten eine Rolle gespielt hat: Die Kompetenzen für eine Pandemie, eine weltweit um sich greifende Epidemie, sollen von den Bundesländern auf den Bund übergehen.

Soll in der Krise übernehmen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. – Foto: BMG
Wenn das so käme, wäre künftig Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die zentrale Figur des Krisenmanagers. Er hätte es im Wesentlichen in der Hand, wie die Gesundheitsversorgung organisiert wird, könnte zentral steuern und sogar medizinisches Personal zwangsverpflichten, in Krankenhäusern tätig zu werden – wenn Not am Mann sein sollte.
Die Länder hätten das Nachsehen
Der Plan ist aus der Not heraus geboren – und soll offenbar auch befristet werden für die Zeit dieser Krise. Das Nachsehen hätten die Länder, die bisher am Zuge sind. Seit sich vor knapp zwei Wochen die Krise rund um Corona zu einem Ausnahmezustand hochgeschaukelt hat, bemühen sich die Akteure im deutschen Föderalismus nach Kräften, ihre eigene Vielstimmigkeit in Grenzen zu halten. Es gibt immer Länder, die mit bestimmten Schritten vorpreschen, sei es die Schließung der Schulen, die Begrenzung der Ausgangsmöglichkeiten oder das Verkaufsverbot in Geschäften.
Wiederholt war es der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der voranmarschierte – und die anderen in Zugzwang setzte. Die sachliche Erklärung, Bayern sei eben wegen der Nähe zu Österreich und Italien und wegen der höheren Infiziertenzahlen stärker betroffen gewesen und habe drastischer vorgehen müssen, überzeugt in der öffentlichen Debatte nicht durchweg. Im politischen Geschäft wird beobachtet, wer die Krise nutzt für klare und deutliche Ansagen – und sich so als Krisenmanager profiliert.
Eine langwierige Debatte wird es nicht geben
Anders als sonst wird es über diesen neuen Gesetzesvorschlag aus dem Hause Spahn keine monate- oder gar jahrelangen Debatten geben. Der ehrgeizige Plan sieht vielmehr anders aus: Die Große Koalition im Bund soll sich am heutigen Montag auf einen Plan verständigen, der Bundestag soll diesen am Mittwoch beschießen, kurz darauf soll dann der Bundesrat zustimmen – und ab Ende der Woche würde das schon gelten. Die Politik kann so in Krisenzeiten Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Im Eilverfahren könnte der Spahn-Entwurf wohl nicht zu 100 Prozent, aber vielleicht zu 80 Prozent umgesetzt und tatsächlich beschlossen werden.
Ein neues Recht des Bundesgesundheitsministers, bundesweite Verordnungen über Infektionsschutz-Schritte verhängen zu dürfen, könnte Erfolg haben, ebenso sein neues Recht, die Versorgung mit Medikamenten und Schutzausrüstungen bundesweit zu steuern und eine Arznei-Mittel-Bevorratung anordnen zu können. Im Entwurf steht noch, dass Spahn medizinisches Personal auch zwangsverpflichten kann zum Dienst in Krankenhäusern – und dass die Handy-Ortung eingesetzt werden soll, um Infektionsketten von Kontaktpersonen der Infizierten nachverfolgen zu können.
Diese Vorgaben reiben sich mit dem Datenschutz und mit der Berufsfreiheit. Gerade linke und liberale Politiker dürften damit grundsätzliche Probleme haben, denn die alte Debatte um Vorratsdatenspeicherung wird hiervon berührt.
Haltung der Länder ist noch nicht klar
Wie die Länder dazu stehen, ist noch nicht absehbar. In Niedersachsen hat sich CDU-Chef Bernd Althusmann wiederholt als Anhänger einer entschlossenen Politik der Einschnitte zu erkennen gegeben. Die Menschen würden das, um der Gesundheit willen, auch erwarten und tolerieren. Die SPD bleibt abwartend, Ministerpräsident Stephan Weil lehnte gestern eine Stellungnahme zum Spahn-Plan ab. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich vorsichtig skeptisch geäußert, doch die Bayern gelten als Pragmatiker und wissen, dass man sich in solchen Zeiten kaum offensiv gegen ein hartes Krisenmanagement stellen kann.
Lesen Sie auch:
Aktuelle O-Töne zur Corona-Krise
Pro & Contra: Sollte der Landtag trotz Corona tagen?
In Hannover haben die Vertreter des Sozialministeriums in den Pressekonferenzen der vergangenen Tage immer wieder betont, wie funktionsfähig der Föderalismus sei und dass die Vorzüge einer bürgernahen Regelung, die auf lokale Besonderheiten Rücksicht nimmt, geschätzt werden sollten. Dennoch zeigte sich gerade am Wochenende, wie höchst verschieden die Realität ist: In Bayern dürfen Menschen nur noch „mit triftigem Grund“ das Haus verlassen – und auch nur in Begleitung von Personen ihrer Hausgemeinschaft. In Niedersachsen gibt es eine solche Beschränkung nicht, hier dürfen sich draußen Personengruppen von maximal zehn Personen aufhalten.
In Hamburg sind es sechs Personen, in Hessen vier – und in Baden-Württemberg lediglich drei. Noch verwirrender wird es, wenn man die Zustände in den 45 Kreisen und kreisfreien Städten Niedersachsens vergleicht. In der Region Hannover durften viele Geschäfte noch offen haben, die im Kreis Osnabrück schon geschlossen haben mussten. Im Kreis Lüneburg gab es strenge Regeln für das Betreten von Lebensmittelläden, in den meisten anderen Gebieten Niedersachsens aber nicht.
Dass bei einem Erfolg der Spahn-Initiative schon in einer Woche diese Vielschichtigkeit enden wird, weil dann der Bund eine einheitliche und im Detail ausformulierte Vorgabe erteilen soll, ist wohl nur einer von mehreren Vorteilen der Reformidee. Allerdings dürfte er nicht der entscheidende sein. Vielmehr sprechen die Verhältnisse dafür, dass der Bund gerade jetzt mehr Zuständigkeiten in dieser Corona-Krise übernimmt:
Knappes Material muss verteilt werden: Noch fehlt es an FFP2-Masken und an Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger, die in den Kliniken die wachsende Zahl an Corona-Erkrankten behandeln müssen. Eine bundesweite Steuerung muss dafür sorgen, dass immer dort genügend Material verfügbar ist, wo es gerade gebraucht wird. Deshalb darf es nicht so sein, dass Bundesländer ihre Bestände horten und nicht abgeben. Die bundesweite Zuständigkeit ist hier ohne Alternative. Auch die Zwangsverpflichtung von Personal für die Kliniken kann bevorstehen, wenn die Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen. Da niemand solche Anordnungen gern trifft, wäre es aus Sicht vieler Länder-Vertreter wohl durchaus sinnvoll, wenn der Bundesgesundheitsminister die unpopuläre Aufgabe übernimmt.
Medikamenten-Notstand droht: Vor allem in China, wo viele Medikamente hergestellt werden, ist nach der dortigen Corona-Krise die Produktion eingebrochen. Die Auswirkungen machen sich bei uns vielleicht erst in einigen Wochen bemerkbar. Wenn Patienten in den Apotheken ihre Tabletten nicht mehr bekommen können, kann das die durch Corona ohnehin verbreitete Angst noch erhöhen. Eine bundesweite Zuständigkeit für Medikamenten-Bevorratung liegt daher nahe.
Der Schritt in die Normalität muss planvoll geschehen: Die Entscheidung darüber, die Schulschließungen zu beenden, die Geschäfte wieder zu öffnen und die Ausgangsbeschränkungen zurückzufahren, kann nicht jedes Land einzeln treffen. Es dürfte zu Unverständnis führen, wenn jene Länder, die weniger stark betroffen sind, früher aktiv werden als andere, die das wegen höherer Ansteckungsgefahr noch nicht tun wollen. Anders als beim Beginn der Krise sollte ihre Beendigung planvoller und besser vorbereitet vollzogen werden. Auch das spricht für die Bundeskompetenz. (kw)