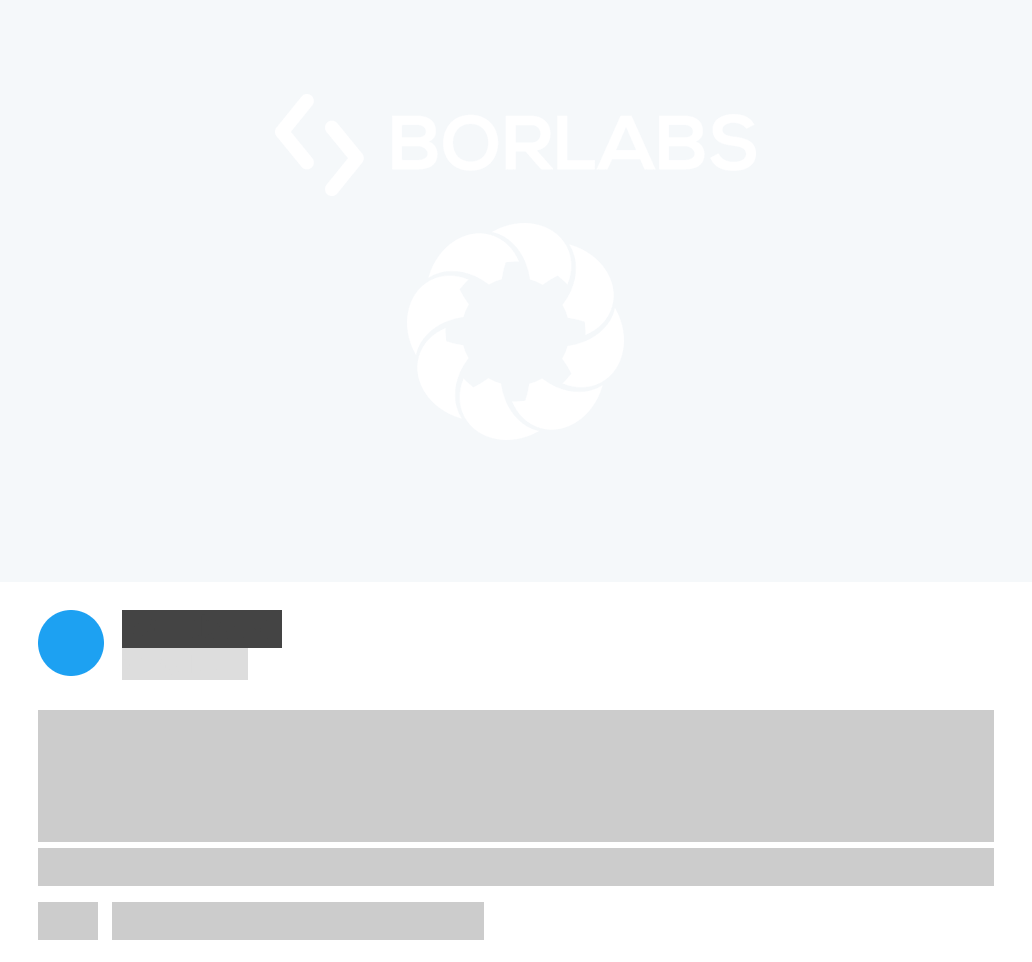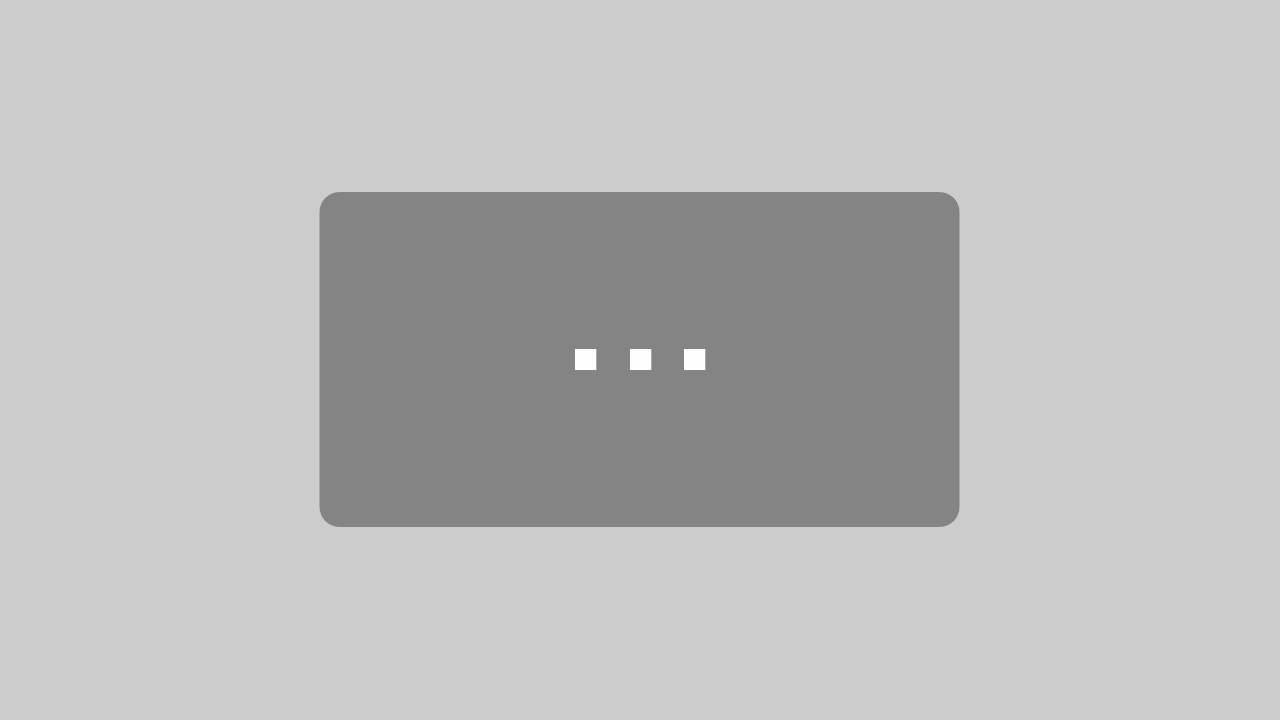Staudte hält Gorleben für „untersuchungsunwürdig“
Mirjam Staudte, atompolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, setzt stark darauf, dass in den ersten Plänen des Bundes für ein Atomendlager Gorleben nicht mehr als möglicher Standort genannt wird. Die Bundesbehörden wollen am Montag in einem ersten Schritt sämtliche geologisch möglichen Standorte in Deutschland nennen, danach soll ein mehrjähriges Auswahlverfahren die möglichen Varianten immer stärker einschränken. Es geht um Salz-, Ton- und Granitgestein als Umgebung.
Staudte sagte, sie halte Gorleben für „untersuchungsunwürdig“, weil ein ausreichend starkes Deckgebirge fehle. Dass im Vorfeld das Kriterium Deckgebirge kein Ausschlussgrund bei der Suche war, sondern nur ein Abwägungsfaktor, sei nicht gut – denn die Akzeptanz der Suche könne darunter leiden. Staudte sagte, man müsse auch über eine bessere Sicherung der oberirdischen Zwischenlager in Nähe der Atomkraftwerke reden, denn es könne gut sein, dass die Endlager-Findung länger dauere als geplant.
Angepeilt wird bisher eine Standortentscheidung im Jahr 2031. An mehreren Stellen fügte die Grünen-Politikerin Kritik hinzu: In Deutschland sei die Forschung bisher zu stark auf Salz-Stöcke fixiert gewesen.
Lesen Sie auch:
„Unverschämtheit“: Weil rügt Bayerns Vorgehen bei Endlagersuche
Endlager-Debatte: Es geht nicht nur um Gorleben
Die Bundesbehörde „Base“ sei als Aufsichtsbehörde ungeeignet, die Öffentlichkeitsarbeit zu leisten – das soll besser dem Nationalen Begleitgremium, in dem Bürgergruppen mitwirken, überlassen. Das im 2020 beschlossenen Geodaten-Gesetz geregelt sei, dass zwar Behördendaten über geologische Untergründe veröffentlicht werden müssen, nicht aber solche von Firmen, sei auch ein Fehler. Das müsse revidiert werden.
Außerdem sehe sie die Gefahr, dass in falschverstandener Eile die Erkundungen von Bergwerken auf zu wenige Standorte konzentriert werden. Die Atomkonzerne hätten immerhin 24 Milliarden Euro für diese Arbeit zur Seite gelegt.